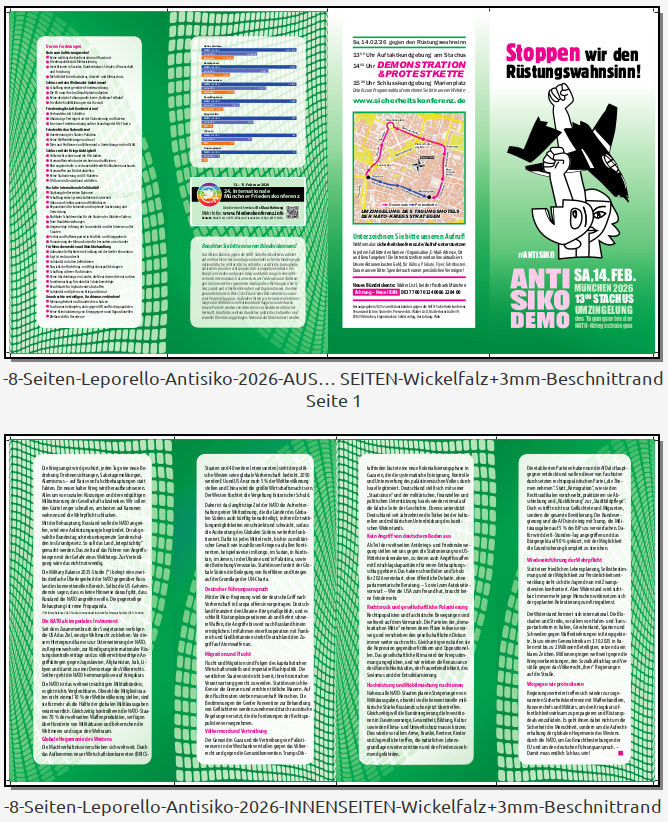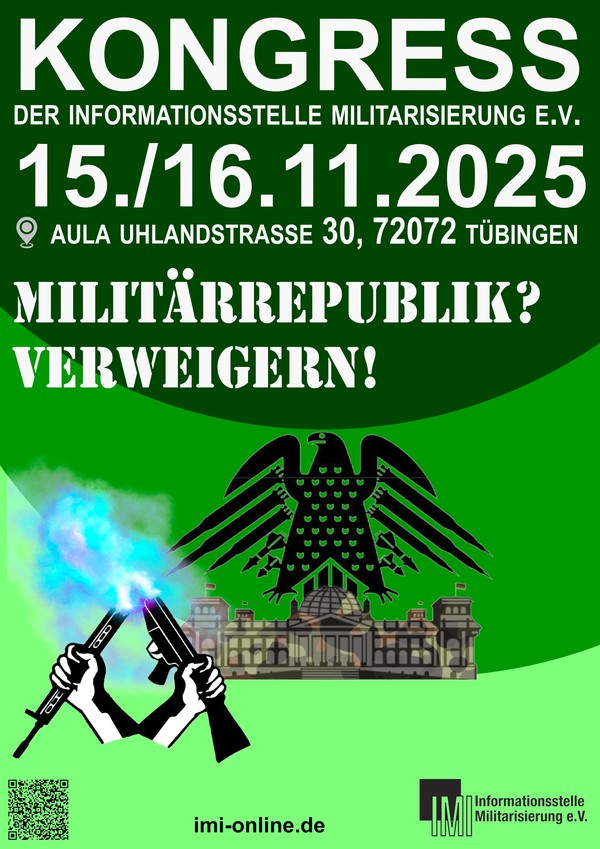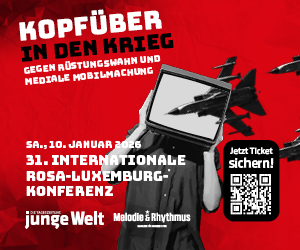Meldungen
Brisanter US-Plan zur Hegemonie: Ukraine, Lateinamerika & Europa
Wir befinden uns derzeit in unserer jährlichen Crowdfunding-Kampagne. Wenn Sie möchten, dass unser unabhängiges und gemeinnütziges Mediennetzwerk auch im Jahr 2025 fortbesteht, beteiligen Sie sich bitte an dieser Kampagne, indem Sie hier klicken. Die Trump-Regierung spricht von „America First“, doch ein neues sicherheitspolitisches Dokument zeichnet ein deutlich komplexeres Bild. In diesem Video, exklusiv auf Deutsch auf […]
Der Beitrag Brisanter US-Plan zur Hegemonie: Ukraine, Lateinamerika & Europa erschien zuerst auf acTVism.
Trotz Snowden: So wuchs der US-Überwachungsstaat weiter
Wir befinden uns derzeit in unserer jährlichen Crowdfunding-Kampagne. Wenn Sie möchten, dass unser unabhängiges und gemeinnütziges Mediennetzwerk auch im Jahr 2025 fortbesteht, beteiligen Sie sich bitte an dieser Kampagne, indem Sie hier klicken. In diesem Video, das exklusiv auf Deutsch auf unserem Kanal veröffentlicht wurde, erklärt der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Journalist Glenn Greenwald, wie seit […]
Der Beitrag Trotz Snowden: So wuchs der US-Überwachungsstaat weiter erschien zuerst auf acTVism.
US-Druck verpufft: Russland & Indien – Ukraine-Plan gescheitert
Wir befinden uns derzeit in unserer jährlichen Crowdfunding-Kampagne. Wenn Sie möchten, dass unser unabhängiges und gemeinnütziges Mediennetzwerk auch im Jahr 2025 fortbesteht, beteiligen Sie sich bitte an dieser Kampagne, indem Sie hier klicken. Russlands Präsident Wladimir Putin besuchte letzte Woche Indien und führte Gespräche mit dem indischen Premierminister Narendra Modi, der den russischen Präsidenten mit großem […]
Der Beitrag US-Druck verpufft: Russland & Indien – Ukraine-Plan gescheitert erschien zuerst auf acTVism.
AUSDRUCK (Dezember 2025)
Weltungleichheitsbericht 2026: Die Schere zwischen Arm und Reich vergrößert sich
Der „Weltungleichheitsreport 2026“ (World Inequality Report, erschienen 2025) ist ein von ForscherInnen um Thomas Piketty, Lucas Chancel und weiteren, regelmäßig erstellter Bericht, der die globale Entwicklung von Einkommens- und Vermögensungleichheit auf der Grundlage umfangreicher historischer und aktueller Daten analysiert. Es handelt sich nicht um ein einzelnes Dokument, sondern bezieht sich auf wichtige Berichte, die Ende 2024/Anfang 2025 veröffentlicht wurden. Der Bericht zeigt, dass die globale ökonomische Ungleichheit weiterhin stark zunimmt, sowohl bei Einkommen als auch bei Vermögen. Die wichtigsten empirischen Befunde lassen sich in mehrere Kernbereiche unterteilen: die Entwicklung der Einkommens- und Vermögensverteilung, regionale Unterschiede, die Rolle von Kapitalrenditen. Erstmalig sind Angaben von Einkommensentwicklung und Klima- und Geschlechterungleichheit mit einbezogen.
Empirische Befunde des Reports: Entwicklung der EinkommenDie zentralen Daten des Reports 2025 bestätigen eine beispiellose Konzentration: Das oberste Dezil, d. h. die obersten 10 %, die Reichsten einer Gesellschaft, ein wichtiges Maß für die Einkommens- und Vermögensungleichheit, hält weltweit über 75% des Vermögens; das oberste 1 % umfasst nahezu 50% der Einkommen. Trotz eines leichten Rückgangs der weltweiten Einkommensungleichheit zwischen Ländern hat sich die Konzentration von Einkommen und vor allem Vermögen innerhalb vieler Staaten verschärft. Seit rund vier Jahrzehnten wächst der Einkommensanteil der obersten 1 bis 10 %. Die Einkommen der globalen Spitzengruppen ergeben sich zunehmend aus Kapitalerträgen, was die Kopplung von Einkommens- und Vermögensungleichheit verstärkt. Der Bericht betont, dass vor allem die reichsten 1 % einen unverhältnismäßig großen Teil des Zuwachses an Einkommen und vor allem Vermögen seit der Jahrtausendwende abschöpfen, während die untere Hälfte der Weltbevölkerung nur einen sehr geringen Anteil erhält. So ist beispielsweise In den USA der Anteil des obersten 1% von 10% auf über 20% angestiegen, während der Einkommensanteil der unteren 50% von 21% im Jahr 1980 auf 13% im Jahr 2025 gefallen ist. Ähnliche Entwicklungen sind in Europa, Asien und Lateinamerika zu beobachten, wobei die Geschwindigkeit der Zunahme regional variiert.
Das folgende Schaubild zeigt den Anteil der obersten 1% je Nationaleinkommen:
Entwicklung der VermögensverteilungDie Vermögenskonzentration ist extrem: Die reichsten 10% der Weltbevölkerung besitzen 76% des globalen Vermögens. Die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung verfügt über weniger als 5% des globalen Vermögens; in keinem Land ist dieser Anteil höher. Die obersten 0,1% der Vermögensbesitzer sollen ihren Anteil von rund 20% im Jahr 2022 auf über 30% bis zum Jahr 2100 ausbauen, was auf hohe Kapitalrenditen und bereits bestehende Vermögensberge zurückzuführen ist.
Die Konzentration von Reichtum und Macht vor allem in den Händen weniger Monopole und Konzerne hat sich weiter verschärft. Eine kleine Zahl von immer größeren Konzernen übt außergewöhnlichen Einfluss auf Wirtschaft und Politik aus, drückt Löhne, übervorteilt Verbraucher und privatisiert öffentliche Güter. Die Weltbevölkerung in ärmlichen und fragilen Ländern wächst stetig, wobei allein in Subsahara-Afrika bis 2030 etwa die Hälfte der globalen Bevölkerung in extremer Armut leben wird.
Die Hauptursache für die wachsende Ungleichheit ist laut Thomas Piketty die ungleiche Verteilung von Kapital. Die Rendite aus Kapital übersteigt regelmäßig das Wachstum der gesamtwirtschaftlichen Einkommen, was bedeutet, dass Vermögen schneller wächst als die Arbeitseinkommen. Dies führt der Berichts-Analyse zufolge dazu, dass die Schere zwischen Vermögenden und Normalbevölkerung immer weiter auseinandergeht. Besonders die reichsten 10 % profitieren von diesem Trend: Sie erhalten 52 % des weltweiten Einkommens, während die ärmste Hälfte nur 8 % erhält. Die Studie betont, dass die Ungleichheit zwischen Ländern seit der Jahrtausendwende leicht zurückgegangen ist, während die Ungleichheit innerhalb der Länder weiter steigt. Besonders in Regionen wie Lateinamerika und dem Nahen Osten sind die Unterschiede extrem: Dort erhalten die reichsten 10 Prozent bis zu 55 bis 58 Prozent des Nationaleinkommens, während die ärmsten 50 Prozent nur 9 bis 10 Prozent erhalten. Thomas Piketty zeigt, dass diese Entwicklungen keine naturgegebenen Gesetze sind, sondern das Ergebnis politischer Entscheidungen, wie Steuersysteme, Bildungspolitik und die Machtverhältnisse im Kapitalismus.
Eine Erklärung zur sich verändernden VermögensstrukturThomas Piketty prognostiziert, dass sich die Vermögensanteile der Top 0,1%, der mittleren 40% und der unteren 50% von heute 43% auf etwa 68% im Jahr 2100 erhöhen, während der Anteil der Top 10% ohne die Top 0,1% von 57% auf 32% sinkt. Dies deutet auf eine De-Konzentration des Vermögens hin, also eine Verringerung der Konzentration im oberen Mittelfeld. Eine ergänzende Recherche ergibt, dass die prognostizierte De-Konzentration im Vermögen kein Zeichen für eine Angleichung ist, sondern ein Beleg für eine Verschiebung der Ungleichheit: Das Vermögen wandert von der breiten Oberschicht zu den Superreichen und zur Mitte/Unten, was die gesamte Vermögensstruktur verändert.
Die De-Konzentration bedeutet demnach, dass sich das Vermögen nicht mehr so stark bei der oberen Mittelschicht (Top 10% ohne Top 0,1%) ballt, sondern zunehmend bei den Superreichen (Top 0,1%), der Mitte und den unteren Schichten konzentriert. Dieser Trend entsteht, weil die Vermögen der Superreichen durch Kapitalrenditen viel schneller wachsen als die Vermögen der breiten Bevölkerung. Gleichzeitig profitieren die mittleren und unteren Schichten – etwa durch Umverteilung, steigende Vermögen oder politische Maßnahmen – relativ stärker als die oberen 10% ohne die Top 0,1%. Thomas Piketty erklärt diese Entwicklung mit seiner "Weltformel" r > g: Die Rendite auf Vermögen (r) ist höher als das Wirtschaftswachstum (g), wodurch sich die Vermögen der Superreichen exponentiell vermehren. Dies führt dazu, dass die Vermögenskonzentration bei den Superreichen immer stärker zunimmt, während die breite Oberschicht (Top 10% ohne Top 0,1%) relativ an Bedeutung verliert. Die De-Konzentration ist also eine Folge der extremen Wachstumsraten bei den Allerreichsten und einer relativen Angleichung zwischen Mitte und unten.
Regionale Unterschiede der EinkommensentwicklungFür das Jahr 2023 zeigt die World Inequality Database, dass die Einkommensungleichheit zwischen den Regionen erheblich variiert. In Europa besitzen die obersten 10% etwa 37% des Gesamteinkommens, im Nahen Osten vergleichsweise sogar 61%. In Ländern wie Brasilien verdienen die oberen 10 % bis zu 29-mal mehr als die unteren 50 %, in Frankreich ist das Verhältnis 7 zu 1. Die Entwicklung ist in Schwellenländern besonders dynamisch, da dort die Deregulierung der Märkte und die Öffnung für globale Kapitalströme die Ungleichheit verstärkt haben. Zwischenstaatlich ist ein gewisser Aufholprozess großer Schwellenländer – etwa in Ostasien – erkennbar, was zur Abnahme der globalen Einkommensungleichheit zwischen Ländern beiträgt. Allerdings bleiben insbesondere Subsahara-Afrika und Teile Südasiens deutlich zurück, sodass die Einkommensschere im Weltsystem strukturell bestehen bleibt und künftige Verringerungen der Ungleichheit stark von der Entwicklung dieser Regionen abhängen. Im folgenden Schaubild sind die Anteile am Nationaleinkommen nach 6 Weltregionen und nach Einkommensgruppen dargestellt.
KlimaungleichheitNeu im Fokus des Weltungleichheitsberichts 2025 steht die Verbindung mit Klimaungleichheit. Der Bericht widmet erstmals ein eigenes Kapitel der Ungleichheit der CO2-Emissionen. Dem Climate Inequality-Report ist zu entnehmen, dass die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung nur 12% der Emissionen verursacht, trägt aber voraussichtlich 75% der relativen Einkommensverluste durch Klimaschäden. Der UN-Global Multidimensional Poverty Index (MPI) 2025 zeigt, dass weltweit 1,1 Milliarden Menschen (18,3% der untersuchten Bevölkerung) in akuter multidimensionaler Armut leben, wobei die Betroffenen vor allem in Subsahara-Afrika (49,2%) und Südasien (34,1%) konzentriert sind. Die Armut ist dabei nicht nur einkommensbasiert, sondern umfasst Defizite in Bildung, Gesundheit und Lebensstandard wie fehlende Zugänge zu sauberer Kochenergie, sanitären Einrichtungen, Elektrizität oder angemessener Ernährung. Parallel dazu weist der globale Index für mehrdimensionale Armut 2025 darauf hin, dass die in multidimensionaler Armut Lebenden erheblichen Klimarisiken ausgesetzt sind, was die sozial‑ökologische Dimension von Ungleichheit weiter verschärft.
Der Weltungleichheitsbericht macht sichtbar, wie extrem sich Einkommen und Vermögen seit 1980 zugunsten des obersten Prozents verschoben haben; aus marxistischer Sicht bestätigt er damit empirisch zentrale Thesen über Klassenspaltung, Kapitalakkumulation und die strukturelle Tendenz zur Polarisierung im Kapitalismus. Problematisch ist aus marxistischer Perspektive jedoch, dass der Bericht Ungleichheit vor allem als Verteilungsproblem behandelt und mit steuer- und regulierungspolitischen Reformvorschlägen im Rahmen des bestehenden Systems beantworten will, statt die kapitalistische Produktionsweise selbst in Frage zu stellen.
GeschlechterungleichheitDer Bericht widmet erstmals auch ein eigenes Kapitel der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern. Frauen leisten weltweit einen entscheidenden Beitrag zu bezahlter wie unbezahlter Arbeit, erhalten dafür aber deutlich geringere wirtschaftliche Anerkennung. Unter Berücksichtigung der Hausarbeit arbeiten Frauen oft länger als Männer, erzielen jedoch weniger Einkommen, besitzen weniger Vermögen und bekleiden seltener Führungspositionen. Selbst steigende Bildungs- und Erwerbsquoten haben die Einkommenslücke kaum verringert. Frauen erzielen heute etwa 35 Prozent des globalen Arbeitseinkommens; in einem geschlechtergerechten System wären es 50 Prozent. In vielen Regionen zeigen sich niedrigere Erwerbsquoten und geringere Stundenlöhne, gepaart mit einem hohen Anteil an prekären, schlechter bezahlten Tätigkeiten; eine Folge der zumeist vorherrschenden kapitalistischen Produktionsstrukturen. Dem Weltungleichheitsbericht zu Folge hat sich global betrachtet die formale Wochenarbeitszeit grob auf etwa 30 bis 40 Stunden eingependelt, Regionale Unterschiede bleiben jedoch groß, nachdem in vielen Ländern des globalen Südens die tatsächlichen Wochenarbeitszeiten deutlich über denen Europas liegen. Die formalen Arbeitszeiten verschleiern, dass Frauen täglich deutlich mehr unbezahlte Sorge- und Hausarbeit leisten und dadurch im Jahresverlauf um Wochen bis Monate mehr arbeiten als Männer. Prognosen zeigen, dass Frauen auch 2050 noch spürbar mehr unbezahlte Arbeit leisten werden, sofern sich die sozial-ökonomischen Rahmenbedingungen und geschlechtsspezifische Normen nicht grundlegend ändern. Die Daten des Berichts zeigen auf, dass eine Gleichheit bei Bildung und Arbeitsmarktzugang zwischen den Geschlechtern nicht besteht.
„Die Welt ist noch weit davon entfernt, die Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen.“ Thomas Piketty
Die nicht erreichte Gleichstellung ist Ausdruck tief verankerter sozialer und ökonomischer Strukturen. Unbezahlte Arbeit bleibt weitgehend außerhalb der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen und entzieht sich damit der politischen Steuerung, obwohl sie zentrale gesellschaftliche Funktionen erfüllt.
Forderungen der AutorenDie Kernthese von Thomas Piketty lautet: Ohne gezielte politische Maßnahmen – insbesondere eine stärkere Steuerprogression, ein internationales Finanzregister und Investitionen in Bildung – wird die globale Ungleichheit weiterhin dramatisch zunehmen. Der Bericht fordert politische Maßnahmen, um die Ungleichheit zu begrenzen: Dazu gehören ein hoher Spitzensteuersatz, ein internationales Finanzregister zur Transparenz von Vermögen, Investitionen in Bildung und eine gerechtere Besteuerung von Kapital. Piketty betont, dass die wachsende Ungleichheit die Demokratie gefährdet und soziale Stabilität untergräbt. Nur durch gezielte Umverteilung und politische Reformen könne eine gerechtere, nachhaltigere Gesellschaft entstehen.
Der Weltungleichheitsreport 2025 bilanziert globale Einkommens- und Vermögensverteilung anhand umfassender Daten der World Inequality Database (WID). Ergänzt durch den Climate Inequality Report 2025 desselben Labors, verknüpft er ökonomische mit klimapolitischen Ungleichheiten. Theoretisch bestimmt der Report Ungleichheit als eine ungleich Verteilungsthematik: Das ungleiche Verhältnis von den obersten 10% gegenüber den unteren 50%“ scheint eine marxistische Klassenanalyse von Kapital vs. Lohnarbeit mit einem entsprechendem Klassenstandpunkt für politische Konsequenzen zu umgehen. Stattdessen gehen die Autoren davon aus, dass progressive Steuersysteme die Ungleichheit wirksam reduzieren könnten. Allerdings ist in diesem Kontext darauf hinzuweisen, dass die Steuerprogression in den reichen Ländern und vielen Schwellenländern seit Beginn der Phase des neoliberalen Kapitalismus (1970) eine gegenteilige Entwicklung nahmen, indem progressive Erbschaftssteuern ausblieben und ein reformistischer Ausbau von Sozialstaats– Maßnahmen, die den Kapitalismus „effizienter und gerechter“ machen sollten, theoretisch blieben und die soziale Ungleichheitsentwicklung nicht aufgehalten haben.
Doch welche gesellschaftliche Funktion erfüllt dieser Report? Aus marxistischer Perspektive stellt sich die Frage nicht nur nach deskriptiver Genauigkeit seiner Daten – die zweifellos imposant sind –, sondern primär nach ihrer strategischen Implikation: Dient der Weltungleichheitsreport 2025 der Stabilisierung eines regulierten, „grünen“ Kapitalismus, indem er extreme Ungleichheiten als korrigierbares Verteilungsdefizit darstellt? Oder eröffnen seine empirischen Befunde Spielräume für eine Analyse jenseits kapitalistischer Vergesellschaftung, die auf Vergesellschaftung der Produktionsmittel abzielt?
Der Weltungleichheitsreport 2025 positioniert sich als eine kritische Kompetenz im Lager eines „regulierten, grünen Kapitalismus“: Er kritisiert extreme Ungleichheit, stellt aber Privateigentum an Produktionsmitteln, Konkurrenz und Profitlogik nicht zur Disposition.
Die dokumentierte Konzentration folgt der Dynamik von Mehrwertaneignung, fallender Profitrate und Überakkumulation, die der Report nicht thematisiert. Besonders anzumerken ist der neu hinzugekommene Bezug zur Klimaentwicklung. Die Krise resultiert nicht primär aus individuellem Fehlverhalten einzelner Emittenten, sondern aus fossiler Kapitalverwertung – Energieinfrastruktur, Rohstoffrendite, Finanzialisierung von „grünen“ Assets. Die Finanzialisierung von „grünen“ Assets beschreibt den Prozess, bei dem nachhaltige Vermögenswerte wie ökologische Investitionen, grüne Anleihen oder nachhaltig finanzierte Projekte zunehmend als Finanzprodukte gehandelt und in das Finanzsystem integriert werden. Damit werden Umweltziele mit Kapitalströmen verknüpft, um gezielt in Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu investieren und gleichzeitig finanzielle Renditen zu erzielen. Der Report schlägt Bepreisung (CO₂-Steuern) und Kompensation vor, was den Kapitalismus lediglich „vergrünt“, ohne die Eigentumsfrage zu stellen.
Ein FazitDer Bericht ist ein enorm wichtiges Programm, dass außergewöhnlich viele international erhobene Daten methodisch sauber aufbereitet. Anzuzweifeln ist jedoch, ob der Report der redlichen Wissenschaftler das Wesen der Ungleichheit adäquat erfasst: Ungleichheit ist nach meinem Verständnis kein Verteilungsfehler, sondern notwendiges Resultat kapitalistischer Produktionsverhältnisse: Mehrwertaneignung, fallende Profitrate und Überakkumulation, die der Report nicht thematisiert. Und somit wird die wachsende Ungleichheit nicht als systemimmanentes Ergebnis des Kapitalismus, eher als individualisiertes Ergebnis des existierenden Wirtschaftssystems gesehen. Die Ausbeutung von Arbeit durch Kapital führt systematisch zu einer Konzentration von Reichtum und Macht in den Händen der besitzenden und herrschenden Klasse. Die kapitalistische Produktionsweise produziert massive Ungleichheit, Reichtum in den Händen weniger, Armut für eine zunehmende Mehrheit. Reformansätze, wofür der Weltungleichheitsbericht plädiert, wie etwa höhere Steuern oder Regulierung von Konzernen greifen zu kurz, weil sie die grundlegenden Klassenverhältnisse nicht verändern.
Die empirisch belegte Vermögenskonzentration rechtfertigt die Vergesellschaftung zentraler Sektoren: Energie, Finanzwesen, Plattformen, Industrie (z. B. Auto-, Tech-Konzerne). Emissionsdaten fordern demokratisch geplante Investitionen: Öffentliche Energie- und Verkehrswende statt einem marktbasiertem Green New Deal.
---------------------------
Quellen:
https://wid.world/news-article/world-inequality-report-2026-coming-out-soon/?ref=surplusmagazin.de
World Inequality Lab: World Inequality Report 2022
World Inequality Database, Report 2025: https://wid.world/
Oxfam: „Takers not Makers“ – Weltungleichheitsbericht 2025, deutschsprachige Adaption „Milliardärsmacht beschränken, Demokratie schützen“.
https://wid.world/www-site/uploads/2025/10/Climate_Inequality_Report_2025_Final.pdf
Surplusmagazin: Pikettys Weltungleichheitsbericht, 2025.
UNDP: Global Multidimensional Poverty Index 2025: https://hdr.undp.org/content/2025-global-multidimensional-poverty-index-mpi#/indicies/MPI
World Bank: Poverty and Inequality Update – Fall 2025.
2030 Agenda: World Inequality Report 2022.
Spiegel: Was im neuen Report von Thomas Piketty steht, 2025
Epstein & Geheimdienste: Wie Trump die Akten weiter geheim hält
Wir befinden uns derzeit in unserer jährlichen Crowdfunding-Kampagne. Wenn Sie möchten, dass unser unabhängiges und gemeinnütziges Mediennetzwerk auch im Jahr 2025 fortbesteht, beteiligen Sie sich bitte an dieser Kampagne, indem Sie hier klicken. In diesem Video analysiert der investigative Journalist und Menschenrechtsanwalt Dimitri Lascaris das kürzlich verabschiedete Gesetz „Epstein Files Transparency Act“, das die Veröffentlichung von […]
Der Beitrag Epstein & Geheimdienste: Wie Trump die Akten weiter geheim hält erschien zuerst auf acTVism.
Kommt die US-Invasion? Venezuela stellt sich auf Krieg ein
Wir befinden uns derzeit in unserer jährlichen Crowdfunding-Kampagne. Wenn Sie möchten, dass unser unabhängiges und gemeinnütziges Mediennetzwerk auch im Jahr 2025 fortbesteht, beteiligen Sie sich bitte an dieser Kampagne, indem Sie hier klicken. In diesem Interview spricht Sharmini Peries mit dem venezolanischen Journalisten Ricardo Vaz über den massivsten US-Militäraufmarsch in der Karibik seit der Kubakrise. Sie […]
Der Beitrag Kommt die US-Invasion? Venezuela stellt sich auf Krieg ein erschien zuerst auf acTVism.
Türkei–Iran: Warum stellt sich Ankara plötzlich gegen Israel?
Wir befinden uns derzeit in unserer jährlichen Crowdfunding-Kampagne. Wenn Sie möchten, dass unser unabhängiges und gemeinnütziges Mediennetzwerk auch im Jahr 2025 fortbesteht, beteiligen Sie sich bitte an dieser Kampagne, indem Sie hier klicken. In diesem Interview spricht der investigative Journalist und Menschenrechtsanwalt Dimitri Lascaris mit Prof. Dr. Foad Izadi über die Beziehungen der Türkei zu Israel, […]
Der Beitrag Türkei–Iran: Warum stellt sich Ankara plötzlich gegen Israel? erschien zuerst auf acTVism.
An den Frieden glauben
Der echte Grund, warum alles teurer wird – und was jetzt wirklich hilft
Wir befinden uns derzeit in unserer jährlichen Crowdfunding-Kampagne. Wenn Sie möchten, dass unser unabhängiges und gemeinnütziges Mediennetzwerk auch im Jahr 2025 fortbesteht, beteiligen Sie sich bitte an dieser Kampagne, indem Sie hier klicken. In diesem Video, produziert von Democracy at Work und dem Left Forum und von uns übersetzt, erklärt Professor Richard D. Wolff, wie in […]
Der Beitrag Der echte Grund, warum alles teurer wird – und was jetzt wirklich hilft erschien zuerst auf acTVism.
Wie Ex-CIA, MI5 und Mossad an Israels Völkermord profitieren
Wir befinden uns derzeit in unserer jährlichen Crowdfunding-Kampagne. Wenn Sie möchten, dass unser unabhängiges und gemeinnütziges Mediennetzwerk auch im Jahr 2025 fortbesteht, beteiligen Sie sich bitte an dieser Kampagne, indem Sie hier klicken. Awz Ventures ist eine Risikokapitalgesellschaft mit Sitz in Toronto, Kanada. Nur wenige Menschen haben zuvor von Awz gehört, aber zu ihren Partnern und […]
Der Beitrag Wie Ex-CIA, MI5 und Mossad an Israels Völkermord profitieren erschien zuerst auf acTVism.
"Quo vadis, Friedensbewegung?" - Vortrag von Andreas Zumach
Die US-Lüge über Venezuela: Glenn Greenwald deckt den Betrug auf
Wir befinden uns derzeit in unserer jährlichen Crowdfunding-Kampagne. Wenn Sie möchten, dass unser unabhängiges und gemeinnütziges Mediennetzwerk auch im Jahr 2025 fortbesteht, beteiligen Sie sich bitte an dieser Kampagne, indem Sie hier klicken. In diesem Video, das exklusiv auf Deutsch auf unserem Kanal veröffentlicht wurde, analysiert der Pulitzer-Preisträger Glenn Greenwald die zentralen Behauptungen der US-Regierung über […]
Der Beitrag Die US-Lüge über Venezuela: Glenn Greenwald deckt den Betrug auf erschien zuerst auf acTVism.
Neu erschienen: Lebenshaus-Rundbrief 127
Hat Trump einen Drogenboss begnadigt? Greenwald deckt auf
Wir befinden uns derzeit in unserer jährlichen Crowdfunding-Kampagne. Wenn Sie möchten, dass unser unabhängiges und gemeinnütziges Mediennetzwerk auch im Jahr 2025 fortbesteht, beteiligen Sie sich bitte an dieser Kampagne, indem Sie hier klicken. In diesem Video, das exklusiv auf Deutsch auf unserem Kanal veröffentlicht wurde, untersucht der Pulitzer-Preisträger Glenn Greenwald die Heuchelei und Widersprüche der US-Politik […]
Der Beitrag Hat Trump einen Drogenboss begnadigt? Greenwald deckt auf erschien zuerst auf acTVism.
Entschieden gegen Kriegsdienstpflicht!
Leak deckt auf: Tiefer Staat sabotiert Ukraine-Frieden
Wir befinden uns derzeit in unserer jährlichen Crowdfunding-Kampagne. Wenn Sie möchten, dass unser unabhängiges und gemeinnütziges Mediennetzwerk auch im Jahr 2025 fortbesteht, beteiligen Sie sich bitte an dieser Kampagne, indem Sie hier klicken. In diesem Video, das exklusiv auf Deutsch auf unserem Kanal veröffentlicht wurde, untersucht der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Journalist Glenn Greenwald, wie der […]
Der Beitrag Leak deckt auf: Tiefer Staat sabotiert Ukraine-Frieden erschien zuerst auf acTVism.
Varoufakis, Thunberg & Albanese: Medien ignorieren Gaza-Demo weitgehend
Wir befinden uns derzeit in unserer jährlichen Crowdfunding-Kampagne. Wenn Sie möchten, dass unser unabhängiges und gemeinnütziges Mediennetzwerk auch im Jahr 2025 fortbesteht, beteiligen Sie sich bitte an dieser Kampagne, indem Sie hier klicken. In diesem Bericht dokumentieren wir den Generalstreik vom 28. November 2025 in Genua, Italien – Teil einer landesweiten Mobilisierung gegen das Kriegsbudget, die […]
Der Beitrag Varoufakis, Thunberg & Albanese: Medien ignorieren Gaza-Demo weitgehend erschien zuerst auf acTVism.
Ukraine-Friedensdeal & Israels Völkermord: Was die Medien verschweigen
Wir befinden uns derzeit in unserer jährlichen Crowdfunding-Kampagne. Wenn Sie möchten, dass unser unabhängiges und gemeinnütziges Mediennetzwerk auch im Jahr 2025 fortbesteht, beteiligen Sie sich bitte an dieser Kampagne, indem Sie hier klicken. In dieser Folge von Die Quelle spricht unser Chefredakteur Zain Raza mit dem internationalen Juristen Dimitri Lascaris über wichtige geopolitische Entwicklungen und analysiert […]
Der Beitrag Ukraine-Friedensdeal & Israels Völkermord: Was die Medien verschweigen erschien zuerst auf acTVism.
IMI Kongress 2025: Bericht inklusive Audios zum Nachhören!
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »