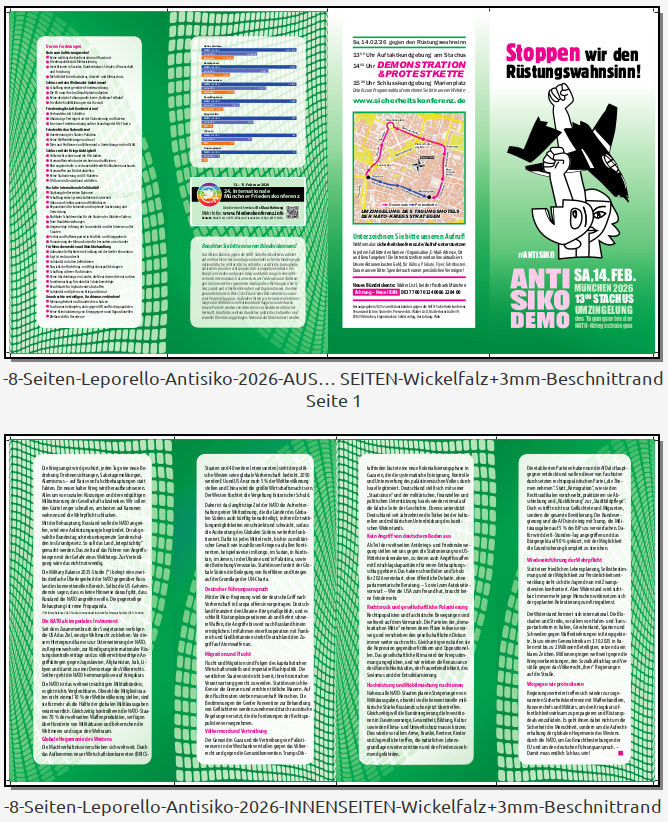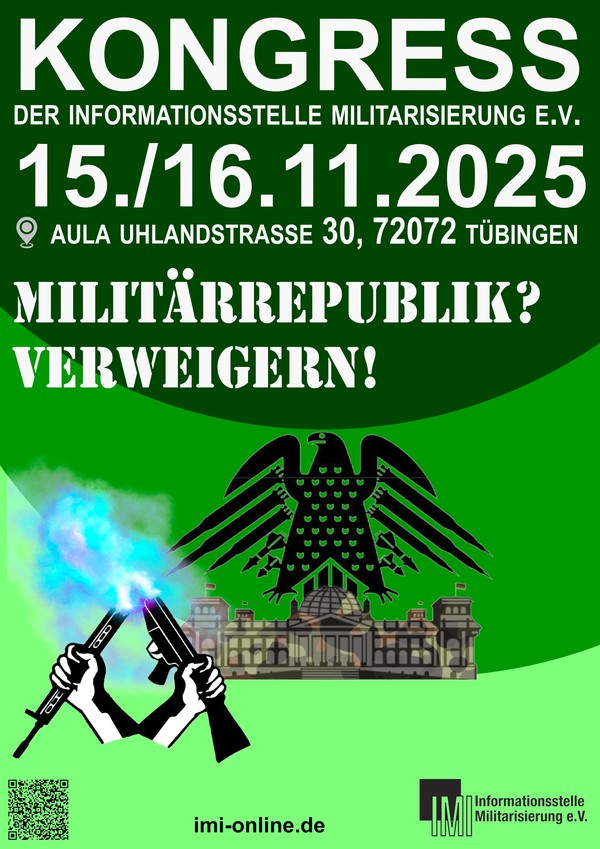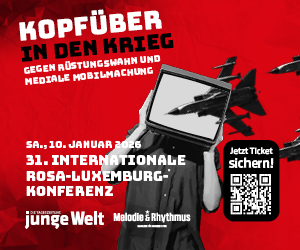Meldungen
2023/10/29 online zoom leading thinkers in conversation
https://www.trybooking.com/events/landing/1130565
Déclaration du Comité international de coordination (ICC) du réseau
Comité international de coordination (ICC) du réseau Déclaration sur la guerre entre Israël et la Palestine Les habitants de Gaza sont actuellement confrontés à l’offensive la plus meurtrière de leur histoire. Cette situation vient s’ajouter à la catastrophe humanitaire causée par le blocus israélien en place depuis 16 ans. Nous condamnons sans équivoque toutes les attaques contre la population civile, y compris les attaques du Hamas contre des civils israéliens qui ont fait des centaines de morts depuis le 7 … Continue reading →
ICC statement on the Israel-Palestine war
International Coordinating Committee (ICC) of the Statement on the Israel-Palestine war Gaza residents are currently facing the deadliest offensive in their history. This comes on top of the humanitarian disaster caused by the Israeli blockade that has been in place for 16 years. We unequivocally condemn all attacks on civilian populations, including Hamas’ attacks on Israeli civilians that have killed over a thousand people since 7 October. However, no attack justifies violations of the laws of war. After nearly three … Continue reading →
2023/10/27-28 Roma.ItalyInternational Conference
https://internationalpeaceconference.info/?language#en
Banner: demilitarize | decarbonize | decolonize
banners, buttons and graphics, produced by Tamara Lorincz, please use them widely.
where’s the $100 Billion for climate finances
banners, buttons and graphics, produced by Tamara Lorincz, please use them widely.
NATO is a threat … abolish the alliance – save the planet
banners, buttons and graphics, produced by Tamara Lorincz, please use them widely.
“NATO is a climate criminal” One of the biggest culprits for Canada’s failure
banners, buttons and graphics, produced by Tamara Lorincz, please use them widely.
fiche d’information : L’OTAN est un danger pour l’humanité et la planète
L’OTAN est un danger pour la planète.pdf
Fact Sheet : NATO IS A THREAT TO PEOPLE AND THE PLANET
NATO is a Climate Criminal_Fact Sheet_2022.pdf
2023/11/25 Berlin, GermanyGroßdemo “Nein zu Kriegen!”
Aufruf „Nein zu Kriegen – Rüstungswahnsinn stoppen – Zukunft friedlich und gerecht gestalten“.pdf Es ist an der Zeit: Bundesweiter Protest gegen Krieg und das soziale Desaster Flyer Berlin 25.11.2023.pdf 17. Oktober 2023 ein Artikel von Reiner Braun (https://www.nachdenkseiten.de/?p=105386) In der Woche vom 27.11 bis 30.11 verabschiedet der Bundestag den Haushalt 2024, der als Kriegsetat zu bezeichnen ist. Dieser zeichnet sich durch ein wesentliches Kriterium aus: Der Rüstungsetat steigt nach NATO-Kriterien auf 88,5 Milliarden Euro und alle Etatposten, die die Bereiche … Continue reading →
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17