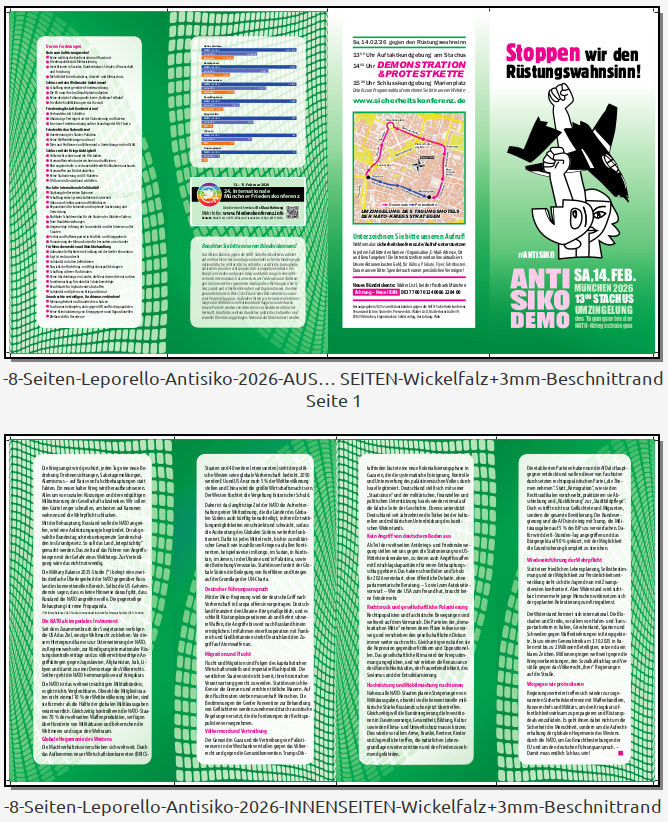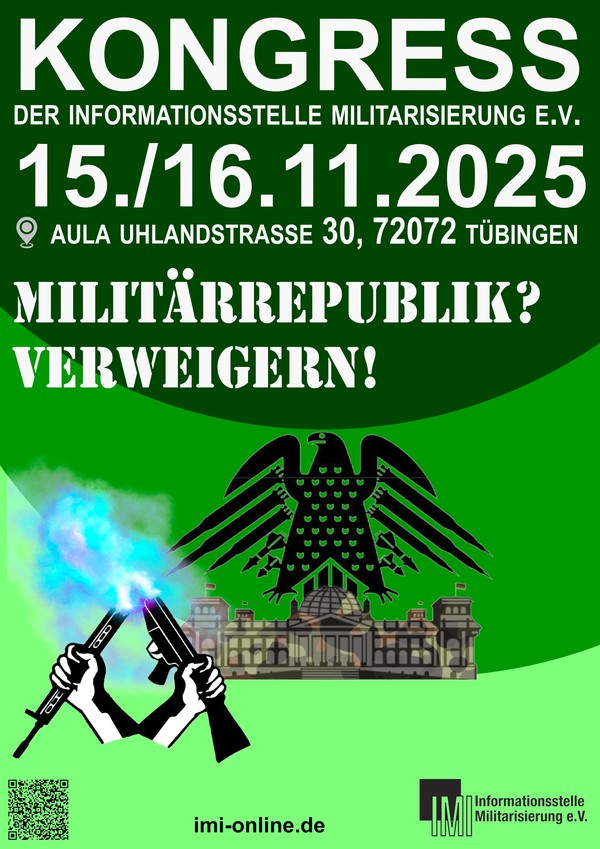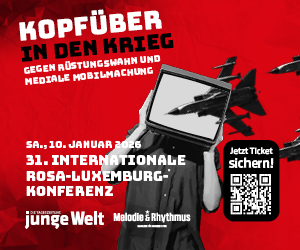ISW München
Die große Illusion: Wie Aufrüstung Deutschlands Deindustrialisierung beschleunigt
Das deutsche Exportmodell steckt in einer Existenzkrise. Eine blockierte Transformation und Elektrorevolution, zwei Jahre konsekutives Negativwachstum, die Schließung und Verlagerung von Industrieunternehmen und damit der massenhafte Abbau von Industriearbeitsplätzen sprechen Bände. Dasselbe gilt für die Zunahme schutzzöllnerischer Vorgehensweisen im Westen, die andeuten: Eigentlich wollten deutsche Automobil- und andere Konzerne den chinesischen Markt erobern, heute nehmen sie den deutschen Staat in die Pflicht zu schützen, was sie schon haben. Die EU steckt im Zangengriff aus hyperwettbewerbsfähiger chinesischer Wirtschaft und Trumps Triumph im Zollstreit mit der EU. Was gegen die Volksrepublik misslang, war an Machtpotenzial für die Europäische Union noch gut genug.
In dieser Situation verspricht die Bundesregierung, dass die größte Aufrüstungswelle seit Ende des Zweiten Weltkriegs zu wirtschaftlichem Wachstum führen werde. Auf der Tagung „Wirtschaftsfaktor Rüstung“, die das Handelsblatt im Sommer veranstaltete, versprach Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), dass die Aufrüstung „auch eine wirtschaftliche und eine technologische Chance für Deutschland“ (1) sei. Einer der zentralen Stichwortgeber der Aufrüstung in Funk und Fernsehen, Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr in München, versprach in der FAZ (2), die Aufrüstung werde zum „Jobmotor“. Moritz Schularick, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft, erwartet im Ergebnis der Rüstungsausgaben immerhin ein Wachstum von 1,5 Prozent für den gesamten Euroraum.
Auch im IPG-Journal der Friedrich-Ebert-Stiftung, der parteinahen Stiftung der im Bund regierenden SPD, verspricht man sich von der Aufrüstung positive Wachstumseffekte. Die IG Metall wiederum sieht sich mit einer Situation konfrontiert, in der an die Stelle von Arbeitsplätzen in der Automobilindustrie und bei ihren Zulieferern nun solche bei den Rüstungskonzernen treten: Ganze Volkswagen-Werke sollen, wie in Osnabrück, in Rheinmetall-Werke umgewidmet werden (3), in Görlitz werden künftig statt Straßenbahnen Panzerfahrzeuge gebaut, auch in Gifhorn, Salzgitter und an anderen Standorten droht eine solche Umwandlung von ziviler in Militärproduktion. Manchem erscheint die Aufrüstung darum als Antidot zur Deindustrialisierung.
Wachstumsmotor Hochrüstung?Was ist nun von diesen Versprechungen zu halten? Ist Rüstungskeynesianismus ein Ausweg aus der Krise der Wirtschaft? Kann an die Stelle des existenzkriselnden Exportmodells nun Hochrüstung als makroökonomisches Allheilmittel treten? Sichert die Aufrüstung kurzfristig Arbeitsplätze, ganz nach dem Keynes’schen Motto: „In the long run we are all dead“, womöglich in einem großen Krieg, aber kurzfristig lassen wir es nochmal krachen? Tatsächlich ist, selbst wenn man ihrer instrumentellen Logik folgt, die Gleichung Aufrüstung gleich Deindustrialisierungsantidot, rein ökonomisch betrachtet, kurzsichtig – und zwar aus sechs Gründen:
Erstens: Insofern die USA den hochgradig monopolisierten Weltmarkt für Rüstungsgüter dominieren – die fünf größten Rüstungskonzerne der Welt sind alles US-amerikanische –, bedeuten die Hochrüstungsmaßnahmen letzten Endes, dass die europäischen Arbeiterklassen mit ihren Steuergeldern die Profite von Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing und Co (4). und die Dividendenausschüttungen an deren Aktionäre finanzieren. Sie bedeuten, dass die europäischen Staaten, ja alle US-Verbündeten ein militärkeynesianisches Rüstungsprogramm finanzieren, aber nicht für sich selbst, sondern in weiten Teilen für die USA. Wirtschaftspolitisch betrachtet könnte man genauso gut Milliardensummen ohne Gegenleistung an Donald Trump überweisen.
Zweitens: Staatliche Ausgaben – militärische wie zivile – führen immer und überall zu direktem und indirektem Wachstum: Investitionen in Rüstung kurbeln die Stahlproduktion an, Investitionen in Gesundheit die Pharmazeutik usw. Das Besondere an Rüstungsausgaben ist jedoch: Sie sind tote Konsumtion. Rüstung funktioniert im Kern wie schlichter Massenkonsum, etwa durch das Versenden von Schecks an die Bevölkerung, die einfach konsumtiv ausgegeben werden. Denn einmal produziert, liegen die Waffen herum; es sei denn, sie kommen in einem Krieg zum Einsatz und es entsteht, wie im militärisch-industriellen Komplex der USA, Dauerbedarf. In jedem Fall erweitern Investitionen in Waffen nicht das kapitalistische Wachstum auf höherer Stufenleiter.
Investitionen in Bildung, Gesundheit, Klimaschutz oder eine andere Industriepolitik versprechen eine deutlich größere konjunkturelle Wirkung, da ihnen ein höherer Multiplikatoreffekt innewohnt, der sich in Form von Arbeitsplätzen, neuen Wachstumsbranchen und Ähnlichem niederschlägt. Jüngere vergleichende politökonomische Forschung zeigt: Investitionen in Umwelt, Bildung und Gesundheit erzeugen in Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien höhere Wachstumsimpulse. Auch in den USA liegt der Multiplikatoreffekt bei Bildung und Gesundheit über dem der Rüstung – lediglich Umweltinvestitionen schneiden dort schlechter ab.
In Deutschland ist das Wachstum durch staatliche Ausgaben für Bildung und Gesundheit fast dreimal so hoch wie bei Rüstung und bei Umweltinvestitionen immer noch fast doppelt so hoch. In Italien entstehen pro eine Million Euro Ausgaben des öffentlichen Sektors drei Arbeitsplätze durch Rüstung, im Bildungssektor dagegen elf.
Je stärker also Investitionen in Umwelt, Bildung und Gesundheit zugunsten des Schuldendienstes für die Aufrüstung gekürzt werden, desto stärker verteilt die Rüstungsproduktion das Wachstum zuungunsten der Beschäftigten: Dem erhofften BIP-Wachstum von 1,5 Prozent stehen geplante Rüstungsausgaben von 3,5 Prozent des BIP gegenüber. Die EU rechnet für Deutschland im nächsten Jahr nun mit einem Wachstum von 1,1 Prozent, die Wirtschaftsweisen haben dies weiter nach unten korrigiert (5), auf 0,9 Prozent.
Drittens: Auch der Beschäftigungseffekt der Kriegswirtschaft ist zu vernachlässigen und kann die Arbeitsplatzverluste in der zivilen Industrie (u.a. in der Autoindustrie) nicht auffangen. Im Allgemeinen ist wenigstens ein Wachstum von 2,5 Prozent vonnöten, um vor dem Hintergrund von Produktivitätssteigerungen und bei gleichbleibend hoher Arbeitszeit das Beschäftigungsniveau zu halten. Während heute also auch in der IG Metall diskutiert wird, ganze VW-Werke in Rheinmetall-Werke umzubauen, um statt Autos Kriegsgerät zu produzieren, sind die Erwartungen an den Beschäftigungseffekt der Hochrüstung eher gering: Neue Studien gehen von 200.000 neuen Arbeitsplätzen (6) aus, die in den nächsten Jahren in Deutschland entstehen könnten. Dagegen steht heute allein in der Autoindustrie, das heißt ohne Zuliefererbetriebe von der Metallerzeugung bis zur Software, der Abbau von 245.000 Stellen seit 2019 und allein 114.000 Stellen im vergangenen Jahr. (7) Hinzu kommt der Stellenabbau der Zulieferer, der sich allein in der Metallerzeugung im vergangenen Jahr auf 12.000 Stellen summierte. Dabei sind sich alle Experten einig, dass die Krise der Autoindustrie gerade erst begonnen hat. Umgekehrt erscheinen die Hoffnungen auf starke Beschäftigungseffekte durch die Waffenproduktion eher optimistisch, da die Panzerfertigung künftig zunehmend automatisiert wird und Kriegsführung zusätzlich immer stärker auf Drohnen verlagert wird.
Viertens: Aufrüstung geht auch zulasten ziviler Produktion. Die Folge ist die Verknappung von zivilen Konsumgütern. Die Folge der Angebotsverknappung wiederum ist Teuerung, Inflation, also ein sinkender Lebensstandard für die Arbeiterklasse. Dieser hat aber zwangsläufig Folgewirkungen für die aggregierte Nachfrage. Davor warnte vor dem Ersten Weltkrieg schon der österreichische Politökonom und Sozialdemokrat Otto Bauer: „Bei aller Sparsamkeit“ könne der Staat die Summen für die Aufrüstung niemals woanders „ersparen“. Das „Defizit“ werde also „natürlich immer größer, wenn die Ausgaben für den Militarismus so schnell wachsen“. Der Staat werde daher „die Steuern erhöhen müssen, um das Defizit zu decken“. Die Folge hiervon: „Wenn der Arbeiter mehr Steuern zahlen muss, kann er weniger für Kleider, Wäsche, Schuhe, Bücher ausgeben.“ Das würden dann aber wieder die Industriezweige, „die diese Waren erzeugen“, zu spüren bekommen; sie „werden weniger Arbeiter beschäftigen können, weil sie weniger Absatz haben“. Im Ergebnis: „Es werden mehr Arbeiter bei der Erzeugung von Mordwerkzeugen, dafür aber weniger Arbeiter bei der Erzeugung von Kleidern, Wäsche, Schuhen, Büchern beschäftigt werden!“ Die Aufrüstung ist also ein Nullsummenspiel, der „Militärkeynesianismus“ eine Scheinrechnung, auch rein ökonomisch betrachtet.
Fünftens: Die Einleitung einer Kriegswirtschaft behindert nun auch die Innovationsfähigkeit der Wirtschaft auf die Dauer. Denn sie verschiebt gesellschaftliche Ressourcen, Ingenieurs-Know-how, Hochschulforschung usw. weg von gesellschaftlichen Zielen wie dem Klimaschutz, der Mobilitätswende und der sozialen Gerechtigkeit, die nicht nur gesellschaftlich sinnvoller wären, sondern eben auch mit höheren Multiplikatoreffekten. Daraus ergibt sich auch eine weitere, alles entscheidende Konsequenz.
Nämlich sechstens: Rüstungspolitik ist kein Antidot zu Deindustrialisierung, sie ist ein Treiber von Deindustrialisierung. Kurz: Zwischen Aufrüstung und dem Verlust der industriellen Basis eines Landes besteht ein sehr enger Zusammenhang. Dies zeigt die Geschichte. Der Aufstieg Chinas wurde erleichtert durch die Tatsache, dass die Volksrepublik nach ihrem Bündnis mit den USA 1972/73 im Windschatten der Vereinigten Staaten sich rein auf die zivile Entwicklung konzentrieren konnte, während die Sowjetunion im „Second Cold War“ von den USA zu einer massiven Aufrüstungslast zulasten ihrer zivilen Produktion gezwungen und letztlich totgerüstet wurde. Die im Weltkrieg von den USA besiegten und besetzten (West-)Deutschland und Japan wurden nach 1945 zu den am weitesten entwickelten Ökonomien des Kapitalismus und zum Hauptkonkurrenten für die USA nicht bloß deshalb, weil ihre Infrastruktur zerstört war, sondern weil ihre Rüstungsausgaben konstant niedrig blieben. Großbritannien und Frankreich hatten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs stetig hohe Militärausgaben mit einer Spezialisierung in der Waffenproduktion, und im gleichen Maße erlebten sie eine schnellere Deindustrialisierung. Die Bundesrepublik Deutschland, Italien und Spanien hingegen weisen historisch vergleichsweise niedrigere Militärausgaben mit einer Spezialisierung in ziviler Produktion auf, und im Ergebnis vollzog sich der Prozess der Deindustrialisierung langsamer oder, im Falle der Bundesrepublik, fast gar nicht. Ein wesentlicher Grund: In Deutschland, Italien und Spanien war historisch der militärische Anteil der Ausgaben für Forschung und Entwicklung (R&D) sehr viel geringer als in Großbritannien und Frankreich.
Mit anderen Worten: Aufrüstung stürzt die EU in verschärftere, nicht geringere Deindustrialisierung, verlangsamt sie nicht, sondern beschleunigt sie. Sie ist sogar in ausschließlich ökonomischer Hinsicht ein schlechter Deal: Höhere Militärausgaben bedeuten weniger Wohlstand und weniger Arbeitsplätze.
Ein militärisch-industrieller Komplex und seine FolgenDie gesellschaftlichen Kosten und politischen Konsequenzen der Aufrüstung sind also gigantisch. Ein Ende des Niedergangs ist nicht in Sicht. Die deutsche Politik stellt die Bevölkerung längst darauf ein: Deutschland werde „buchstäblich ärmer“, sagte schon zu Beginn des Ukrainekriegs und der Sanktionspolitik der damalige Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Auch Friedrich Merz, damals noch CDU/CSU-Oppositionsführer und Bundeskanzler in spe, stimmte die Bevölkerung auf niedrigere Erwartungen ein. Die besten Jahre lägen hinter uns, sagte er damals und meinte damit natürlich nicht sich und seine Klasse. Nach der Wahl verknüpfte Kanzler Merz die Ankündigung der Hochrüstung mit der Ankündigung von massiven Sozialkürzungen und Lebensarbeitszeitverlängerungen: Das „Paradies“ sei vorbei.
Heute sagen Vertreter der Bundesregierung, dass die Rente „nicht mehr zum Leben reichen“ (8) werde, dass die Lohnabhängigen künftig bis 70 arbeiten (9) müssten und dass, wer das Renteneintrittsalter dann tatsächlich noch erreicht und nicht vorher schon aus Erschöpfung in die Grube fährt, dann auch seine Medikamente nicht mehr bezahlt (10) bekommen soll.
Die SPD hoffte, mit der Aufhebung der Schuldenbremse für die Rüstung dem Widerspruch Raketen oder Rente, Kampfschiffe oder Kindergärten, Schützenpanzer oder Schulen zu entkommen. Diese Rechnung wird nicht aufgehen. Industrieumbau, soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz werden mit der Hochrüstung unter die Räder kommen. Der Grund ist simpel: Die Kosten der Aufrüstung lassen sich zwar in die Zukunft verlagern und zukünftigen Generationen aufbürden, sofern ein großer Krieg verhindert wird und es diese dann noch gibt. Die Tilgung der Schulden aber, die mit der unbeschränkten Kreditaufnahme für die Aufrüstung entstehen, wird aus dem laufenden Haushalt geschehen müssen. Dierk Hirschel, Chefökonom der Gewerkschaft Verdi und Mitglied von DL21 in der SPD, hat in dem neuen Buch „Gewerkschaften in der inneren Zeitenwende“, das die IG-Metall-Gewerkschaftssekretärin Ulrike Eifler aus Würzburg herausgegeben hat, vorgerechnet, dass der Schuldendienst schon 2027 die finanziellen Spielräume für Ausgaben in allen anderen Bereichen – Arbeit, Bildung, Gesundheit, Rente – im Grunde ganz und gar austrocknen wird. Die Aufrüstung gerät in einen extremen Gegensatz zur Verteilung und zur sozialen Gerechtigkeit – genau das, was die Sozialdemokraten mit der Grundgesetzänderung eigentlich verhindern wollten.
Aber auch strukturell verändert die Hochrüstung das Gemeinwesen. Sie macht den Staat erpressbar. Dies wusste Otto Bauer ebenfalls längst, als er den Militarismus vor dem Ersten Weltkrieg kritisierte. Die Hochrüstung vergrößere, schrieb er seinerzeit, nämlich die „Abhängigkeit des Staates vom Großkapital“, woraus sich ergebe, dass der Staat dem Kapital dienstbar werde und dem Kapital für seine Kredite dankbar sein müsse. Die Regierung bedanke sich bei den Großkonzernen durch Willfährigkeit: Sie ermögliche durch Arbeitszeitgesetze eine ununterbrochene Produktion, schmettere die Forderungen der Sozialdemokratie nach dem Achtstundentag nieder und erfülle alle Kapitalbedingungen, wodurch die „Gesundheit der Arbeiter“ geschädigt und die „Zahl der Betriebsunfälle“ zunehme. Ergebnis: „Für die Unternehmer 50 Millionen Profit, für die Arbeiter zwölf- und 18-stündige Arbeitszeit“ – das sei der „volkswirtschaftliche Nutzen“ der Aufrüstung.
Wesentlich ist außerdem: Durch die Aufrüstung entsteht eine strukturelle Festlegung der deutschen Gesellschaft, die sich später nur schwer politisch korrigieren lässt. Nach innen wird die Gesellschaft von der Aufrüstung abhängig – es werden Geister gerufen, die sie nicht mehr loswird. Am Ende droht, wie in den USA, die Entstehung eines militärisch-industriellen Komplexes. Kommunen würden um Gelder aus den neuen Rüstungsausgaben in Höhe von fünf Prozent des BIP – das entspricht jedem zweiten Euro im Bundeshaushalt – konkurrieren, und die Wiederwahl von Politikern könnte davon abhängen, ob sie Rüstungsproduktion im eigenen Gebiet ansiedeln oder Mittel für die „Kriegstüchtigkeit“ der Infrastruktur sichern.
Ein einmal entstandener militärisch-industrieller Komplex muss ständig neue Gefahren erzeugen, Bedrohungsszenarien über Stiftungen, Denkfabriken und Medien verbreiten und Wege finden, die angeschafften Waffenarsenale zu nutzen oder zu zerstören. Das bedeutet – wie der US-Komplex zeigt – einen Zustand permanenter Kriegsführung.
----------------------------
Quellen:
(2) https://x.com/CarloMasala1/status/1894380659012989132
-----------------------
Der Betrag ist an 18. November 2025 in der Berliner Zeitung erschienen
Ingar Solty ist Autor und lebt in Berlin. Im Frühling erscheint sein neues Buch „Der postliberale Kapitalismus: Renationalisierung – Krise – Krieg“.
Merz’ rassistische Ablenkung hat Tradition
Die Stadtbild-Debatte ist nicht nur ein Schauspiel des Alltagsrassismus in Deutschland, sondern auch ein Ablenkungsmanöver: Unzufriedenheit soll sich an Ausländern entladen statt an der Politik, die dabei versagt, lebenswerte Städte für alle zu schaffen.
Die Äußerung von Bundeskanzler Friedrich Merz, es gäbe »im Stadtbild noch dieses Problem«, das durch verstärkte Abschiebungen gelöst werden könne, hat es nun geschafft, wochenlang die Öffentlichkeit zu beschäftigen – samt Gegenprotesten, Unterstützungsbekundungen und leidenschaftlichen Mediendebatten. Dass Merz selbst laut Umfragen momentan von nur knapp einem Viertel der Bevölkerung unterstützt wird oder dass die Wirtschaft nach wie vor stagniert, tritt in den Hintergrund zugunsten einer erneuten Migrationsdebatte.
Merz’ Kommentare kamen nicht aus dem Nichts, sondern verdeutlichen das Weltbild des deutschen Bundeskanzlers: von den »kleinen Paschas«, über den »importierten Antisemitismus« von Menschen, die in den letzten zehn Jahren nach Deutschland gekommen seien, bis zur »ungeregelten Einwanderung in unsere Sozialsysteme«. Diese Kontinuität macht deutlich, dass »der Ausländer« in seinem Denken ein beständiges Problem darstellt, das weg muss.
Doch es gibt auch eine andere Kontinuität in Merz’ Handeln: Das geschickte Ausnutzen von rassistisch aufgeladener Rhetorik, um von sozialer Spaltung abzulenken und Ungleichheit zu normalisieren. Hieß es in den 1990er Jahren noch »Das Boot ist voll«, wird heute anhand eines angeblich verfallenden Stadtbilds ein Feind an die Wand gemalt, der für die gesellschaftliche Misere verantwortlich sein soll.
Worum es wirklich gehtDie Stadtbild-»Debatte« macht eine ganze Bandbreite von rassistischen und sexistischen Stereotypen deutlich. Menschen mit Migrationsgeschichte würden den Sozialstaat ausnutzen, um sich ein leichtes Leben zu machen und, wann immer sie wollen, in der Stadt abzuhängen, denn sie müssten nicht arbeiten.
Dahinter steckt ein Sozialchauvinismus, der arme Menschen abwertet, Hass auf sie schürt und von der eigentlichen Frage ablenkt: von Armut betroffene Menschen haben sich ihre Lebenslage nicht selber ausgesucht, sondern sind aufgrund von Klassenverhältnissen in sie hineingeboren. Versuche, ihnen zu entkommen, werden durch die Bundesregierung erschwert. Mehr noch: Sie betreibt tagtäglich eine Politik, die die Menschen in Armut, Rechts- und Statuslosigkeit drängt, nur um es ihnen dann persönlich zum Vorwurf zu machen.
Einen Tag später, auf Nachfrage, was Merz denn konkret meine, antwortete er: »Fragen Sie mal Ihre Töchter.« Damit markiert er die von ihm gemeinten Menschen als potentiell gewalttätige und sexuell übergriffige Männer. Das Bild des »Ausländers«, der es auf deutsche Frauen abgesehen habe, ist ein immer wiederkehrender Topos im systematischen Alltagsrassismus hierzulande – insbesondere, wenn es um Schwarze Menschen geht.
Merz inszeniert sich dabei als schützender Patriarch, so die politische Soziologin Rosa Burç: »Frauen, die nur als ›Töchter‹ Subjekte sind, Männer, die nur dann als gefährlich markiert werden, wenn sie migrantisch sind, migrantische Irregularität eingeschrieben in die Illusion einer weißen Nation«. Eine Petition von Aktionskünstlerin Cesy Leonhard macht deutlich, um was es eigentlich geht: »Wir haben ein strukturelles Problem mit Gewalt gegen Frauen – fast immer im eigenen Zuhause. Die Täter sind nicht irgendwelche Menschen im ›Stadtbild‹, sondern Ehemänner, Väter oder (Ex)Partner.«
Merz nachträgliche Spezifizierung, es gehe ihm um »Einwanderer ohne Aufenthaltsrecht und Arbeit, die sich nicht an die in Deutschland geltenden Regeln halten« würden, macht es nicht besser. Erstens kann man den Aufenthaltsstatus eines Menschen nicht an seinem Gesicht ablesen. Genauso wenig den Arbeitsstatus – viele Menschen mit Migrationshintergrund sind gezwungen, in prekärer Situation ermüdende Schicht- oder Nachtdienste zu leisten. Und welche Regeln Merz meint, bleibt ebenso nebulös. Sind es Gesetze, Werte oder Normen? Welche möglichen Regelbrüche insinuiert er? Es wird deutlich, dass diese Unklarheit Teil einer Kommunikationsstrategie ist, die gleichzeitig jeden und fast niemanden meinen könnte.
Eine rassifizierende und ausschließende Einordnung ermöglicht Merz’ Aussage hingegen schon. Denn betroffen von dieser Markierung sind potentiell alle, die von einer weißen Dominanzgesellschaft nicht als deutsch gelesen werden und sich den Tag über in öffentlichen Räumen aufhalten. Nicht umsonst äußerte sich der Überlebende des rechtsterroristischen Hanau-Anschlags Said Etris Hashemi: »Ich bin das Stadtbild, vor dem Merz warnt. Die 9 Menschen, die in Hanau ermordet wurden, wurden Opfer genau dieser Denkweise.« Zu dem Stadtbild, das nicht sein darf, gehören auch Shishabars, die sich der Attentäter als Ort seines Anschlags unter anderem ausgesucht hatte.
Zweitens wird deutlich, dass es sich empirisch nur um eine sehr geringe Menge an Menschen handelt, die sich »ohne Aufenthaltsrecht« im Land befinden. Mit Stand Ende Juni 2025 befanden sich etwa 226.000 Menschen ausreisepflichtig im Land. 185.000 von ihnen hatten jedoch eine Duldung, sodass nur etwa 41.000 Menschen konkret ausreisepflichtig sind. Neben abgelehnten Asylbewerbern können dies auch Studierende oder Touristen sein, deren Visum abgelaufen ist.
Die Duldung ist zwar kein echter Aufenthaltstitel, aber dennoch eine Bescheinigung über den legalen Aufenthalt. Sie kann erteilt werden aufgrund von völkerrechtlichen oder humanitären Gründen, bei Absolvierung einer qualifizierten Berufsausbildung, wenn man ein minderjähriges Kind hat, das eine Aufenthaltserlaubnis hat, wegen schwerwiegenden Erkrankungen oder aus anderen rechtlichen Gründen, die eine Ausreise verhindern, zum Beispiel fehlende Reisedokumente und ungeklärte Identität. Die Chance, eine der von Merz im Nachgang angeblich gemeinten Personen im Stadtbild einer der 80 Großstädte, 624 Mittelstädte oder der 2.112 Kleinstädte zu sehen, ist damit im realen Leben verschwindend gering.
Erfolgreich abgelenktEs wird deutlich, dass rassistische Platzzuweisungen funktionieren. Migration wird zum Problem stilisiert, weil es politisch nützlich ist. Die Zufriedenheit der Bevölkerung mit der Bundesregierung ist im Keller. Laut einer Insa-Umfrage sehen 66 Prozent der Befragten die Arbeit der Bundesregierung kritisch, nur noch 25 Prozent sind zufrieden. Um davon abzulenken, setzen Merz und Konsorten in bezeichnender Regelmäßigkeit darauf, die nächste rassistische Migrationsdebatte zu schüren.
Denn sie funktioniert jenseits konkreter Empirie. Mit unter 88.000 Erstanträgen bis Ende September 2025 ist die Zahl der Asylsuchenden so niedrig wie in den letzten zehn Jahren nicht mehr. Bis Ende Juni gab es in der gesamten EU nur 399.000 Asylanträge und damit 23 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Diese Problematisierung funktioniert sehr ähnlich zum Sozialchauvinismus, der sich in der Verschärfung des Bürgergelds ausdrückt, das nun Grundsicherung heißen soll. Auch hier wurden Fantasiezahlen von 100.000 faulen »Totalverweigerern« in die Debatte gebracht – in Realität handelt es sich nur um eine sehr kleine fünfstellige Zahl an Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen die Zusammenarbeit mit dem Amt nicht schaffen.
Die »Reform« wurde zudem von der Union dafür gepriesen, 5 Milliarden Euro einzusparen. Tatsächlich werden für 2026 nur rund 86 Millionen Euro und für 2027 rund 69 Millionen Euro an Einsparungen erwartet. 2028 könnte es sogar Mehrkosten geben. Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass die Stadtbild-Debatte genau dann von Merz geschürt wurde, als sich die Versprechungen der Union in Bezug auf die neue Grundsicherung als Luftnummer erwiesen.
Im Kern der Debatte geht es um Entrechtung und eine Hierarchisierung der Gesellschaft, um Lohnarbeit und die Legitimierung von Ungleichheit, um die Zuweisung des »angestammten« Platzes in einem rassistisch strukturierten, kapitalistischen Arbeitsmarkt. Wie die Sozialwissenschaftlerin Bafta Sarbo schreibt: »Je prekärer die Arbeitskräfte sind, desto ausgelieferter sind sie. […] Deshalb ist jede noch so rassistische Mobilisierung gegen Migrantinnen und Migranten kein Kampf gegen Migration an sich, sondern ein Angriff auf die Rechte dieser Menschen.« Den als Probleme des Stadtbilds markierten Menschen mit unsicherem Aufenthaltsstatus sollen diese Rechte vorenthalten werden. Sie werden markiert und ausgeschlossen.
Die ständige Problematisierung von Migration und Flucht ist in Deutschland letztendlich auch ein Vorwand, um nicht über die Themen sprechen zu müssen, die eigentlich anstehen: die Umverteilung gesellschaftlichen Reichtums von oben nach unten, Investitionen in die marode Infrastruktur des Landes oder auch die so dringend notwendige sozial-ökologische Transformation.
Erstveröffentlichung auf jacobin
Wirtschaftliche Stagnation in Deutschland
Die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands ist seit dem I. Quartal 2024 bis zum III. Quartal 2025 (Oktober) geprägt von Stagnation, leichten Rückgängen und minimaler Erholung, wie die Anfang November 2025 veröffentlichten Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen.
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) blieb im 3. Quartal 2025 preis-, saison- und kalenderbereinigt im Vergleich zum Vorquartal unverändert bei 0,0%. Im Vorjahresvergleich konnte das BIP leicht um 0,3% zulegen, womit sich die gesamtwirtschaftliche Leistung ohne nennenswertes Wachstum präsentiert. Zuvor war im 2. Quartal 2025 ein Rückgang um 0,2% zum Vorquartal verzeichnet worden, der vor allem auf eine schlechtere Entwicklung im Verarbeitenden Gewerbe und Baugewerbe zurückzuführen ist. Der Auftragseingang (ein Konjunkturindikator) im Verarbeitenden Gewerbe hat sich im September 2025 gegenüber dem Vormonat leicht um 1,1% preisbereinigt erhöht, was auf eine gewisse Erholung hindeutet. Allerdings waren die Aufträge im November 2024 und 2025 rückläufig.
Die Produktionsauslastung im Verarbeitenden Gewerbe und Baugewerbe ist weiterhin unter Druck, mit rückläufiger Produktion in nahezu allen Bereichen, ausgenommen Fahrzeugbau, der leichte Zuwächse verzeichnet.
Im Außenhandel kam es im 2. Quartal 2025 zu einem Rückgang der Exportvolumina um 0,1% gegenüber dem Vorquartal, was vor allem auf sinkende Warenexporte (-0,6%) zurückzuführen ist, während der Dienstleistungsexport um 1,4% zulegen konnte. Die Importe stiegen im gleichen Zeitraum deutlich um 1,6%.
Im Jahresdurchschnitt wird für das Jahr 2025 ein BIP-Wachstum von gerade einmal 0,2 % prognostiziert, was strukturell so gut wie Stagnation bedeutet.
BIP-Entwicklung in Quartalen von I/2024 – III/2025Die preis-, saison- und kalenderbereinigten BIP-Daten des Statistischen Bundesamtes für Deutschland im Zeitraum von Q1/2024 bis Q3/2025 zeigen folgende Entwicklung:
Die Zahlen belegen, dass die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands im genannten Zeitraum von Schwankungen und einer insgesamt weitgehend stagnierenden Entwicklung geprägt ist. Die BIP-Werte wachsen mit kleinen Ausschlägen nach oben und unten, was die instabile wirtschaftliche Lage beschreibt.
Die vorliegenden Zahlen offenbaren strukturelle Krisen der kapitalistischen Produktionsweise, die sich im Kontext multipler Krisen und eines seit Jahren anhaltenden Stagnationstrends deutlich manifestieren. Diese Entwicklung drückt im Kern die kapitalistische Krisenhaftigkeit aus, in der strukturelle Widersprüche wie Nachfragefluktuationen Überakkumulation, und internationale Standortkonkurrenz den Wirtschaftskreislauf begrenzen.
Überakkumulation und NachfrageschwächeDie Investitionstätigkeit kapitalistischer Unternehmen bleibt trotz niedriger Zinsen gering, weil am Standort Deutschland die erforderlichen Investitionen in die Produktions-Anlagen und den Erhalt von Arbeitsplätzen unternehmerisch eine zu geringe Profitabilität erbringt. Hinzu kommt, dass gerade der Kapitalstandort Deutschland durch die exorbitant hohen Energiekosten und Infrastrukturproblemen massiv unter Druck steht.
Die Nachfrage insbesondere durch den privaten Konsum wird durch stagnierende Löhne, Preissteigerungen der Lebenshaltungskosten für Lebensmittel, Wohnraum, öffentlichen Einrichtungen durch die derzeit dominanten politischen Eliten gebremst. Die CDU/CSU/SPD-Regierung ist alles andere als die politische Vertretung derjenigen, die durch ihre Arbeitsleistung das BIP erarbeiten. Die in der Vergangenheit und bis zum heutigen Tage konzipierten staatlichen Konjunkturimpulse dieser Regierung sind in zu geringem Maße auf strukturelle Verbesserungen bzw. Erweiterungen des Industriestandortes ausgerichtet. Dauerhaft dürfte sich das auch durch Steuergeschenke und Subventionen für die großen Konzerne nicht kompensieren lassen. Hinzu kommt, dass die notwendige energetische und ökologische Transformation (Dekarbonisierung) erhebliche Umbruchkosten bedeuten, die aus Unternehmersicht die Profiterwartungen im traditionellen Verarbeitenden Gewerbe zusätzlich schmälern.
Die wirtschaftliche Situation ist folglich durch Überakkumulation geprägt, in der sich im kapitalistischen Wirtschaftssystem mehr Kapital anhäuft, als profitabel investiert wird. Dies führt zu einer sogenannten Verwertungsschranke, nachdem die Arbeitsproduktivität zwar leicht zunimmt, gleichzeitig aber der Einsatz von Arbeit durch massiven Stellenabbau abnimmt, was die Profitrate senkt. Überakkumulation entsteht also aus dem inneren Widerspruch des Kapitalismus: das Kapitalvolumensteigt, aber die Möglichkeit seiner gewinnbringenden Anlage verringert sich.
Als exportabhängige Volkswirtschaft ist Deutschland besonders stark von den verschärften internationalen Konflikten und den von den USA praktizierten Protektionismus betroffen. Die Schwäche des Weltmarkts wirkt im kapitalistischen Prozess der Akkumulation als ein externer Schock auf die heimische Wirtschaft, der eigentlich nach rationalen ökonomischen Einschätzungen ein Umdenken der wirtschaftlichen Kooperation und der eigenständigen Mitgestaltung des Welthandels erfordern würde.
Sozialausgaben und demografische VeränderungenDer Anstieg von Sozialausgaben infolge des demografischen Wandels und der politisch erklärten antisozialen Ausrichtung der gegenwärtigen Regierungspolitik, sprich: Rückentwicklung des Sozialsystems bei gleichzeitiger Ausgaben-Expansion für die Militarisierung sind Ausdruck einer Politik, die den Spielraum für gesellschaftsrelevante staatliche Interventionen einschränkt. Gleichzeitig wachsen die Differenzen in der Einkommens- und Vermögensverteilung zu Gunsten der Reichen des Landes weiter.
Grenzen der KrisenbewältigungDie politischen Maßnahmen und kurzfristigen fiskalischen Impulse der Regierung sind nicht darauf ausgelegt, diese Grundwidersprüche einer stagnierenden Wirtschaft nachhaltig zu überwinden. Auch im Digitalisierungszeitalter ist das, was sich als politisches Krisenmanagement in Deutschland abspielt, keine Garantie für ein produktives Wachstum und Erhalt des gesellschaftlichen Wohlstands. Stattdessen wiederholen sich Elemente einer anhaltenden Periode niedrigen Wachstums und periodischer Krisen. Und die Tendenzen zur Monopolisierung und weiteren gesellschaftlichen Polarisierung verstärken sich. Die aktuelle Krise ist in diesem Sinne nicht primär eine Folge einzelner rechtspolitischer Fehlentscheidungen, sondern Ausdruck der Krisenhaftigkeit des kapitalistischen Produktionsverhältnisses selbst.
Internationale EinordnungIm internationalen Vergleich belegt Deutschland im Jahr 2025 (bis Ende Quartal III gerechnet) den letzten Platz unter den führenden Industrienationen. Laut aktuellen OECD-Prognosen wächst das deutsche Bruttoinlandsprodukt nur um 0,4 % – langsamer als in allen anderen entwickelten Volkswirtschaften. Zum Vergleich: Für die Eurozone erwartet die OECD ein Wachstum von rund 1,3 %, für die Vereinigten Staaten etwa 2,4 %.
Diese Zahlen unterstreichen den anhaltenden Rückgang der wirtschaftlichen Dynamik in Deutschland und damit den schwindenden Einfluss des deutschen Kapitalismus im globalen Wettbewerb. Es ist Ausdruck einer ungleichen Entwicklung innerhalb einer sich von einer unipolaren zu einer multipolaren verändernden Weltwirtschaft, in der aufsteigende Staaten des globalen Südens der Vormachtstellung der bisher einflussreichsten kapitalistischen Staaten, auch von Deutschland, mit zunehmendem wirtschaftlichen und geopolitischen Gewicht begegnen.
Die BIP-Entwicklung der letzten vier Quartale macht die strukturelle Stagnation des deutschen Kapitalismus sichtbar. Diese Stagnation ist kein zufälliges Politik-Ergebnis, sondern Resultat grundlegender Krisenmechanismen der Produktion und Verwertung im globalen Maßstab. Die politische Arena wird daher in den kommenden Jahren weiter vom Ringen um Krisenlösungen zwischen (neo-)liberaler, sozialdemokratischer und rechter Verwertungspolitik geprägt bleiben, während die grundlegende Überwindung kapitalistischer Beschränktheiten optimistischerweise bestehen bleibt.
---------------------
Quellen:
https://www.isw-muenchen.de/broschueren/reports/222-report-142
https://www.oecd.org/de/publications/2025/06/oecd-economic-surveys-germany-2025_b395dc9b.html
Xinjiang: Boomregion nach erfolgreichem Kampf gegen Terrorismus
Falls im Westen und speziell im deutschen Sprachraum jemand überhaupt etwas mit dem Begriff “Xinjiang” verbinden kann, assoziiert der Name dieser chinesischen Provinz wahrscheinlich brutale Verfolgung und (kulturelle) Auslöschung einer ganzen Ethnie, der Uiguren. Die Uiguren sind ein Turk-Volk, meistens Muslime. Verfolgt und ausgelöscht von der chinesischen Regierung wegen ihrer Religion und weil sie keine Han-Chinesen sind. So jedenfalls die im Westen verbreitete Erzählung. Beispielhaft das Buch: “Ein Volk verschwindet. China und die Uiguren“ (1), 2022 erschienen und auch von der Bundeszentrale für politische Bildung an den Schulen etc. verbreitet. Geschrieben von einem Journalisten der Zeitschrift Wirtschaftswoche, der seine steile, marktgängige These kaum auf eigene Untersuchungen stützt, sondern auf dünne Belege zweiter und dritter Hand.
Als ich im Sommer die Einladung vom chinesischen Außenministerium bekam, an einer Reise von Journalisten und Publizisten durch Xinjiang teilzunehmen, war ich begeistert. Denn ich kenne zwar viele Teile Chinas und bin auch schon durch Tibet gereist, hatte bislang aber nie Gelegenheit, selbst nach Xinjiang zu kommen. Dabei können Bürger der meisten EU-Länder China und damit auch Xinjiang 30 Tage visumsfrei besuchen.
Zweifellos verfolgte das chinesische Außenministerium mit dieser Einladung die Absicht, international eine andere, positive Botschaft von der Lage in Xinjiang zu verbreiten. Mir war auch klar, wir würden keine Gefängnisse oder Arbeitslager sehen. Aber einmal sehen ist besser als tausendmal hören oder lesen. Ich wollte selbst einen Eindruck von der Situation in Xinjiang gewinnen. Ich wollte besser verstehen, was dran ist an den Berichten von der brutalen chinesischen Repression gegen die Uiguren. Binsenweisheiten wie: “Wo es Rauch gibt, gibt es auch Feuer!” oder "Die Wahrheit liegt in der Mitte.“ reichten mir nicht zur Beurteilung der Ereignisse der letzten 20 Jahre in Xinjiang und zur Einordnung der Horror-Stories über Xinjiang im Westen.
Mein Gesamteindruck aus den drei großen Städten, die wir besuchten (wir waren nicht in den ländlichen Regionen Xinjiangs): Das Leben ist nicht anders als sonstwo in China. Das gilt auch für die Polizeipräsenz und die angebliche Überwachung rund um die Uhr. Im Straßenbild mischen sich Menschen verschiedenster Ethnien. Straßenschilder, offizielle Aushänge etc. sind in Mandarin UND in arabischen Schriftzeichen. Xinjiang wird mit massiven staatlichen und privaten Investitionen entwickelt, den Menschen in der Provinz geht es vergleichsweise gut, sie haben eine Perspektive. Xinjiang mit seinen wundervollen Landschaften ist auch das Ziel von Millionen chinesischen Touristen.
Xinjiang: dreimal so groß wie Frankreich, aber nur 26 Millionen EinwohnerDie Reise war organisiert vom chinesischen Außenministerium zusammen mit der Regierung der uigurischen autonomen Region Xinjiang. Uiguren sind die größte ethnische Gruppe in Xinjiang. Deshalb der besondere Status von Xinjiang als autonomer Region gegenüber anderen chinesischen Provinzen. In der Reisegruppe waren 24 Journalisten, Schriftsteller und Medienvertreter aus 19 Ländern. Die achttägige Tour führte von der Provinzhauptstadt Ürümqi nach Südwesten ins 1.500 km entfernte Kaschgar (chinesisch: Kashi) mit mehrheitlich uigurischer Bevölkerung und in die Region Ily im Nordwesten von Xinjiang an der Grenze zu Kasachstan.
Xinjiang ist etwa dreimal so groß wie Frankreich; es nimmt über 17% der Fläche von ganz China ein. Es grenzt an die Äußere Mongolei, Russland, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Afghanistan und Pakistan. Es ist also “Grenzland", was auch der chinesische Begriff für die Region: Xinjiang = “neue Grenze“ reflektiert. Große Teile sind Wüste oder unwirtliche Hochgebirge; der zweithöchste Gipfel der Welt, der K2, liegt in Xinjiang. Das Gebiet ist dünn besiedelt mit nur 15 Einwohnern pro qkm. Zum Vergleich: In der Provinz Shandong an Chinas Ostküste leben 646 Menschen pro qkm. 2020 hatte Xinjiang knapp 26 Mio. Einwohner, davon 45% Uiguren, 40% Han-Chinesen, außerdem verschiedene andere Ethnien wie Hui, Kasachen, Kirgisen, Mongolen, Tadschiken, Usbeken, Russen und Tibeter.
Xinjiangs strategische Bedeutung in der Kaiserzeit und heuteZweifellos ist Xinjiang mit seiner exponierten Grenzlage zu Zentralasien und zum indischen Subkontinent und als Einfallstor ins chinesische Kernland ein begehrtes und umkämpftes geopolitisches Ziel. Für das bis 1911 existierende chinesische Kaiserreich war die Kontrolle und Sicherung der westlichen Grenzen deshalb immer eine strategische Aufgabe. Davon zeugen alte Festungen in der Gegend von Ily nahe der Grenze zu Kasachstan. Für jeweils fünf Jahre schickte der chinesische Kaiser Beamte aus Peking als Kommandanten nach Ily. Wenn sie sich bewährt hatten, wurden sie im System der Meritokratie, der Auswahl nach Leistung, befördert. Als Arbeitskräfte wurden Strafgefangene eingesetzt. Denn Xinjiang war auch kaiserliche Strafkolonie. Und schon im vorletzten Jahrhundert siedelten sich Chinesen aus dem überbevölkerten Ostchina in Xinjiang an.
Nicht nur die chinesischen Kaiser, sondern auch die russischen Zaren wollten Xinjiang kontrollieren, mit wechselndem Erfolg. In den Jahrzehnten nach dem Zerfall des Kaiserreichs 1911 und nach dem Sieg der russischen Oktoberrevolution 1917 über das Zarenreich gehörte dieser Landesteil formal zur Republik China. In Xinjiang wie anderswo in Zentralasien entstanden zu der Zeit politische Bewegungen für nationale Unabhängigkeit. Sie propagierten die Unabhängigkeit Xinjiangs bzw. des vorwiegend von muslimischen Turkvölkern besiedelten Südwestens der Provinz. 1947 wurde mit Unterstützung der sowjetischen KPdSU die kommunistisch geführte Volksrepublik Ostturkestan gegründet. Die Volksbefreiungsarmee unter Mao war zu der Zeit gerade damit beschäftigt, die Bauern in Chinas Landgebieten und schließlich die großen Städte zu befreien. Nach Ausrufung der Volksrepublik China 1949 übernahm die chinesische Regierung auch die Kontrolle über die Grenzprovinzen Tibet und Xinjiang.
Als 40 Jahre später die Sowjetunion zerfiel und die an Xinjiang angrenzenden früheren Sowjetrepubliken ihre staatliche Unabhängigkeit erklärten und aus der Sowjetunion austraten, bekam der uigurische Separatismus einen ganz neuen Schub. Die Nachbarschaft Xinjiangs zu Afghanistan, wo US-gesponsorte Islamisten wenige Jahre zuvor die sowjetischen Besatzungstruppen vertrieben hatten, tat vermutlich ein Übriges. In Xinjiang begann eine Welle des separatistischen, islamistischen Terrors, der wohl erst durch die Repressionskampagne der chinesischen Regierung gestoppt werden konnte.
Ausbildung, Infrastruktur und Wachstum als Basis für EntwicklungGute Ausbildung, funktionierende Infrastruktur und wirtschaftliches Wachstum sind überall auf der Welt die elementaren Voraussetzungen für die gesellschaftliche Entwicklung. Aus Sicht der chinesischen Politik ist dies auch die Basis, um Extremismus und Separatismus erfolgreich zu bekämpfen.
Xinjiang hat viele Bodenschätze – darunter Öl und Gas und Polysilizium als Rohstoff für die Solarindustrie. Die Landwirtschaft bietet Erzeugnisse wie Wein, Obst, Milchprodukte aus dem Nordwesten oder Baumwolle. Ein Viertel der Weltproduktion von Baumwolle stammt aus dieser Region. Ihr Nachteil ist die riesige Entfernung von den wirtschaftlichen und industriellen Zentren: fast 4.000 km bis nach Shanghai, etwas weniger als die Entfernung vom Nordkap bis nach Sizilien. Aber die chinesische Regierung entwickelt Xinjiang jetzt als Brücke nach Eurasien und Europa. Damit wird aus der Randlage der Region ein Trumpf. Denn Xinjiang hat eine zentrale Rolle im geopolitischen Projekt der Neuen Seidenstraße (Belt and Road Initiative BRI). Das Wirtschaftswachstum in der Region betrug zuletzt 7%.
Schon seit Jahrtausenden wird Xinjiang von Karawanen von Ost nach West und umgekehrt durchquert. Die Ausstellungen in den Museen Xinjiangs belegen die wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung dieser alten Handelswege. Heute sind modernste Logistikzentren in Ürümqi für die Route über Kasachstan und im Süden bei Kashgar für den Weg über Tadschikistan entstanden. 2018 wurde der Binnenhafen Ürümqi International Land Port als Knotenpunkt der Neuen Seidenstraße gegründet. Die Neue Seidenstraße kann die geopolitische Rolle Chinas tiefgreifend verändern und für die gesamte eurasische Region neue. Wachstumschancen eröffnen.
Seit Gründung hat dieser «trockene Hafen» in Ürümqi Investitionen in Milliardenhöhe angezogen und sich zu einem Wirtschafts- und Verkehrszentrum mitten auf der zentralasiatischen Landmasse etabliert. China ist darüber mit mehr als 50 europäischen Städten und aufstrebenden Märkten in Zentralasien verbunden. Der Binnenhafen von Ürümqi ist heute eine multimodale Drehscheibe zwischen Schiene, Straße und Luft. Güterzüge verbinden China über Schienenkorridore durch Kasachstan, Russland, Polen und Deutschland.
In den neuen, staatlich finanzierten Industrieparks investieren vor allem Staats- und Privatkonzerne aus Ost- und Südchina. Der Eisenbahnkonzern CRCC baut hier riesige Maschinen zur Baumwollernte. Der staatliche Autokonzern GAC aus Guangzhou im Perlflussdelta hat in Ürümqi ein nagelneues Montagewerk für Elektroautos. Ein Privatunternehmen aus der Technologiemetropole Shenzhen produziert in der Nähe zur Grenze nach Kasachstan Batterien. Für alle Beschäftigten gleich welcher Ethnie gelten die gleichen Arbeitsbedingungen und die gleiche Bezahlung.
Westliche Investoren sind kaum vertreten, obwohl sich hier im äußersten Westen Chinas und in den angrenzenden Ländern neue Märkte entwickeln. Der VW-Konzern hat sein über 10 Jahre bestehendes Montagewerk in Ürümqi geschlossen - wohl auf Druck der USA und von westlichen regierungsfinanzierten NGOs. Ebenso BASF. Auch hinter der nagelneuen Textilmaschinenfabrik der schweizerischen Saurer-Gruppe in Ürümqi mit den Marken Saurer, Emag und Schlafhorst steckt kein westlicher Investor mehr, sondern ein privater Konzern aus Shanghai, die Jinsheng-Gruppe. Die hat schon vor Jahren diese Perlen des europäischen Maschinenbaus übernommen.
Weil Xinjiang dünn besiedelt ist und zudem ein ausgeprägt kontinentales Klima hat mit viel Sonne und Hitze im Sommer und Kälte im Winter, ist es ein idealer Standort für riesige Solarparks. Aus dem Flugzeug gewinnt man einen Eindruck, in welchem Tempo China den Ausbau der erneuerbaren Energien speziell in Westchina vorangetrieben hat.
Chinas Ethnien- und ReligionspolitikFindet in Xinjiang ein kultureller Genozid an den Uiguren statt? Sollen die Uiguren zwangsweise sinisiert werden? So die inzwischen veränderte westliche Propaganda gegen China, nachdem Horrorgeschichten über Völkermord oder Genozid an den Uiguren nicht belegt werden konnten und international zu wenig Echo fanden.
Auf unserer Reise durch Xinjiang gab es aber keine Hinweise für die Unterdrückung der uigurischen Kultur und der Traditionen und Bräuche. Die Freiheit, die Sprache der eigenen Ethnie oder Nationalität zu nutzen und weiterzuentwickeln, ist in der chinesischen Verfassung festgeschrieben. In Xinjiang erscheinen Zeitungen in insgesamt sechs verschiedenen Sprachen. Die offizielle Zeitung Xinjiang Daily erscheint täglich viersprachig. Verlage publizieren Zeitschriften und Bücher in sechs Sprachen.
Gleichzeitig ist Mandarin die universelle Sprache, die alle Staatsbürger Chinas beherrschen sollen. Bei zwei Besuchen in Kindergärten konnten wir erleben, wie die kleinen Kinder in Mandarin UND in der uigurischen Sprache unterrichtet werden. Auch das Lernmaterial ist mehrsprachig. Waren das Fake-Inszenierungen speziell für unsere internationale Gruppe? Wahrscheinlich nicht. Denn China versteht sich – so die Vorträge von chinesischen Professoren – als multi-ethnischer Staat, der kulturelle Diversität fördert. Das ist die offizielle Politik und nicht etwa die erzwungene Sinisierung der ca. 140 Mio. Staatsbürger, die keine Han-Chinesen sind, sondern Angehörige nationaler Minderheiten.
Eine Randbemerkung: Deutschland mit 25% Staatsbürgern und über 30% Einwohnern nicht-deutscher Abkunft könnte vielleicht von China lernen und die Propaganda von der bio-deutschen, christlich geprägten Leitkultur endlich beerdigen.
Dass China die Bedeutung des Mandarin als universelle Sprache des Landes betont, liegt an den Bemühungen um die Integration der Uiguren und der anderen Ethnien in die Gesellschaft. Eine Ausbildung auf einer einheitlichen sprachlichen Grundlage fördert den gesellschaftlichen Zusammenhalt und eröffnet Arbeits- und Studienperspektiven im ganzen Land. Es gebe in China keine erzwungene Integration der verschiedenen Ethnien, Ziel sei die natürliche Integration und die Inklusion aller Ethnien.
Allerdings wird die Turk-Sprache Uigurisch an den Schulen nur bis zur Unteren Mittelschule unterrichtet, wie in allen Regionen ethnischer Minderheiten. Das kann man kritisieren. Auch chinesische Studien zeigen, dass in Han-Schulen in Ürümqi teilweise schon das Sprechen der uigurischen Sprache sanktioniert wird. Der Sinologe Heberer zitiert zahlreiche Berichte chinesischer Wissenschaftler, die diskriminierendes Verhalten von han-chinesischen Funktionären gegenüber Uiguren festgestellt haben. (2)
Zur Kulturpolitik in Xinjiang gehören aber auch über 100 öffentliche Bibliotheken, 60 Museen und 50 Kunstgalerien. Im vorwiegend uigurisch geprägten Kashgar gibt es ein modernes Science Museum über vier Ebenen, das in der Qualität mit dem Deutschen Museum in München vergleichbar ist und das auch neueste Entwicklungen wie KI und Robotik verständlich und erlebbar macht.
In China gilt Religionsfreiheit. Jede/r kann nach seiner Facon selig werden. Moscheen oder buddhistische oder taoistische Tempel oder christliche Kirchen werden von vielen Gläubigen besucht, wie jeder China-Reisende sehen kann. Für Chinas Religionspolitik gilt aber gleichzeitig die Devise, die staatliche Einheit zu sichern und deshalb jede Einmischung von außen zu unterbinden. Das gilt für den Vatikan ebenso wie für fundamentalistische US-Evangelikale, für muslimische Religionskrieger oder für den Dalai Lama.
Die Trennung von Religion und Staat wird strikt vollzogen. Das hindert die chinesischen Staatsorgane aber nicht daran, die Renovierung oder den Neubau von Kirchen, Moscheen und Tempeln zu finanzieren. So hat die Provinzregierung in Ürümqi ein nagelneues Muslim-Institut mit angeschlossenem Internat gebaut, an dem auch künftige Imame ausgebildet werden. Natürlich sollen gläubige Muslime damit auch auf den chinesischen Staat festgelegt werden. Aber das ist allemal besser als etwa die in Deutschland praktizierte Ausgrenzung der islamischen Religionsstätten in triste Gewerbegebiete –bei gleichzeitiger Klage darüber, man wisse nicht, ob da vielleicht Salafisten ausgebildet würden.
Ob –wie im Westen behauptet – im Rahmen der Repression der vergangenen Jahre gegen den islamistischen Terror Moscheen im großen Maßstab planvoll zerstört worden sind, ließ sich nicht in Erfahrung bringen. Aber es ist nicht wahrscheinlich.
Separatismus und Terrorismus und staatliche Repression in XinjiangEine große Ausstellung in Ürümqi informiert über den Terrorismus und Separatismus in der Provinz und in ganz China. Das Ausmaß des Terrors, den islamistische uigurische Terroristen von 1990 bis 2016 begangen haben, ist im Westen unbekannt. Ich selbst wusste nur von einem Pogrom 2009 in Ürümqi, als uigurische Terroristen mehr als 200 Han-Chinesen töteten und Geschäfte und ganze Straßenzüge abfackelten. Jahre später fuhren uigurische Terroristen auf dem Tiananmen-Platz in Peking mit einem LKW in eine Menschenmenge und töteten dutzende, meistens Touristen. Uigurische Terroristen veranstalteten 2014 auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs Kunming, etwa 3000 km von Urumqi entfernt, mit Macheten ein Massaker mit über 30 Toten. Die USA hatten die verantwortliche Organisation hinter den Massakern, die East Turkestan Islamic Movement ETIM, schon 2002 als terroristische Organisation eingestuft. Aber 2020, noch in der ersten Präsidentschaft von Trump, wurde diese Klassifizierung aufgehoben.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass das CIA-Pentagon-Terrorismus-Franchise im benachbarten Afghanistan im Zusammenspiel mit uigurischen Islamisten eine perfekte Kampagne zur Destabilisierung der Region inszeniert hat.
Spätestens nach dem Massaker 2009 in Ürümqi gab es viele Stimmen vor allem in den sozialen Medien in China, die das Versagen der Regierung kritisierten. Sie hätte die Bürger nicht geschützt, außerdem werde in die Gebiete der ethnischen Minderheiten zu viel Geld gesteckt. Besonders die Uiguren und die Tibeter seien undankbar. Im tibetischen Lhasa hatte es nämlich 2008, punktgenau zur Olympiade in Peking, ein Pogrom gegen Han-Chinesen mit dutzenden Toten gegeben. Ein Schelm, wer dabei an ausländische Einflussnahme denkt!
Nach den Terroranschlägen in Xinjiang wurden in anderen Provinzen Lokalbehörden auf eigene Faust aktiv und stoppten mit der lokalen Polizei Züge mit Arbeitsmigranten aus Xinjiang. Die Züge sollten eigentlich in die Industriegebiete an der Ostküste fahren, mussten aber umkehren. Nach Berichten aus dem Perlflussdelta, dem Herz der “Fabrik der Welt", weigerten sich Unternehmer, Uiguren zu beschäftigen. Das sei ein Sicherheitsrisiko, außerdem könnten sie nicht gut arbeiten.
Gegen diesen Terror, der nicht nur die Sicherheit in Xinjiang bedrohte, sondern die Stabilität und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in ganz China in Frage stellte, legte die chinesische Zentralregierung ein massives Repressionsprogramm auf. Es zielte vor allem auf Uiguren. Dabei wurden zeitweilig auch persönliche Freiheitsrechte außer Kraft gesetzt, wie chinesische Behördenvertreter gegenüber einer Delegation deutscher China-Wissenschaftler offen zugegeben haben. (3) Es kann als sicher gelten, dass Uiguren zeitweilig in Arbeitslager kamen zur Umschulung und politischen Bildung. Aber die in den deutschen Medien ständig wiederholte Zahl von zeitweilig 1-2 Mio. Uiguren in Arbeitslagern erscheint absurd. Das hätte bei ca. 10 Mio. Uiguren insgesamt – inklusive Kleinkindern und Alten – bedeutet, dass alle uigurischen Männer im besten Alter zwischen 16 und 40 weggesperrt waren. Das ist nicht glaubhaft.
Inzwischen hat die chinesische Regierung die gesellschaftliche und politische Situation in Xinjiang offensichtlich erfolgreich stabilisiert. Das hat auch unsere Reise gezeigt. Ob der politische Preis dafür zu hoch war, ist schwer zu beurteilen. An der Reise teilnehmende türkische Journalisten berichteten von keinen Problemen, auf der Straße und privat mit Uiguren ins Gespräch zu kommen. Uigurisch ist eine Turksprache. Nur manchmal habe es Unsicherheiten gegeben.
Nachwort: Kognitive Kriegsführung des Westens gegen ChinaNach der Reise lässt sich feststellen, dass das Ausmaß der westlichen Desinformation über Xinjiang auch die Vorstellungen eines kritischen Medienkonsumenten sprengt. Die Wahrheit über den Terror und die Repression in Xinjiang liegt nicht in der Mitte, sondern ziemlich auf der Seite Chinas. Leider konnte China seine eigene Darstellung im Westen offensichtlich nicht rüberbringen.
Dagegen waren Journalisten und Medienvertreter aus dem sog. Globalen Süden mit einer ganz anderen Sicht auf die Ereignisse nach Xinjiang gekommen.
In einem Vortrag mit der Überschrift “Cognitive warfare or journalistic practice information. Manipulation by some countries” befasste sich Prof. ZHENG Liang von der Jinan University mit der westlichen Berichterstattung über Xinjiang speziell und über China im Allgemeinen.
Ein paar Highlights aus seinem Vortrag:
- In den Fotosammlungen im Netz und in Printmedien von angeblich eingekerkerten Uiguren sind auch Bilder von Schauspielern aus Hongkong.
- In der BBC-TV-Berichterstattung über China und Xinjiang erscheint China immer im Grauschleier, auch wenn chinesische Bilder vom selben Ort und zur selben Zeit blauen Himmel zeigen.
- Die zeitweilige FBI-Mitarbeiterin Sibel Edmonds berichtete auf der Plattform X, dass die USA zwischen 1996 und 2002 jede einzelne terroristische Aktion in Xinjiang geplant, finanziert und bei der Ausführung unterstützt haben.
-----------------
Fußnoten
(1) Philipp Mattheis: “Ein Volk verschwindet. China und die Uiguren”, Berlin 2022
(2) Thomas Heberer: “Sicherheitsdilemma und Nationsbildung: Politisch-gesellschaftliche Hintergründe der Entwicklung in Xinjiang’, in: siehe Fußnote 3
(3) Gesk, Heberer, Paech, Schaedler, Schmidt-Glintzer: “Xinjiang – eine Region im Spannungsfeld von Geschichte und Moderne. Beiträge zu einer Debatte”, Münster 2024
Die Ostseeregion – tausend Jahre Kriege ohne Ende
Die Ostseeregion war in der Vergangenheit bis in das 20. Jahrhundert hinein ständiger Schauplatz erbitterter Konflikte und Kriege zwischen den Völkern. Nun droht sie erneut zum Kriegsschauplatz zu werden. Und Russland steht wieder als Feind auf der Tagesordnung.
Dabei in vorderster Reihe die baltischen Staaten. Für den estnischen EU-Abgeordneten Riho Terras, Mitglied der Fraktion der EVP (Christdemokraten) und ehemaliger Generalstabschef seines Landes, stellt die russische Bedrohung ein historisches Muster dar: „Ein russischer Angriff ist jederzeit möglich. Da sind wir nicht blauäugig. In den letzten tausend Jahren wurden wir 42-mal von Russland angegriffen – im Schnitt alle 25 Jahre“ (Terras, 2025).
Hier wird Geschichte instrumentalisiert und gerät zu mythenbildender Geschichtspolitik mit polemisch zugespitzter Zahlenspielerei für die Feindbildproduktion, zumal es vor tausend Jahren auch noch gar keinen Staat Estland gab. Allerdings sind Mythen- und Symbolbildung in unterschiedlichen Formen und Farben keinem Staat und keiner Gesellschaft fremd. So dient auch im nahen Russland seit 2005 die Befreiung Moskaus von polnischen Truppen und das Ende polnischer Besatzung im Jahre 1612 wieder als ein nationales Symbol. Daran wird mit einem Gedenktag am 4. November erinnert. Nach der Oktoberrevolution war er gestrichen worden.
Vor diesem Hintergrund soll ein Blick auf die wechselvolle Geschichte in der Ostseeregion und des Baltikums geworfen werden. Eingangs werden einige wichtige Entwicklungslinien und die Bedeutung des Kriegsschauplatzes Baltikum kurz vorgestellt. Dem schließen sich Stationen des Aufstiegs Russlands zur Großmacht an Ostsee und in Europa an, wobei der I. und II. Weltkrieg nicht behandelt werden. Mit Ausnahme eines kurzen, wenig bekannten Krieges zwischen beiden Kriegen, dessen Auswertung für die Kriegführung Deutschlands im I. Weltkrieg entscheidend war.
Das Hochmittelalter – Beginn von Ostexpansion, Kreuzzügen, Konflikten und pausenlosen KriegenDer Beginn dieser Entwicklungen ist eng mit dem Entstehen (ständischer) Nationen verbunden, die durch das Scheitern der universalistischen Mächte Kaiser und Papst entstanden waren und in Konkurrenz gerieten. Wichtig für Kriege dazu der große religiöse Bruch im Jahre 1054 zwischen dem lateinisch-römischen und griechisch-orthodoxem Glaubens- und Lebensraum und die sich allmählich abzeichnenden Auseinandersetzungen zwischen Protestantismus und Katholizismus. So wurde die von vielen Völkerschaften umgebene Ostsee zu einer von Macht- und Herrschaftsinteressen durchdrungenen Region, stets auf der Suche nach Machtausbau, Landgewinn, ausbeutbaren Agrar- und Waldflächen, künftigen Geldquellen und lukrativen Handelsgeschäften unter Einsatz aller dafür notwendigen Mittel und Methoden. Und im Zuge der Ostexpansion richtete sich der Blick immer wieder auch auf Russland mit seiner gewaltigen Landfläche, den enormen Ressourcen und begehrten Handelswaren. Und für Russland rückte der Kampf um den freien Zugang seines Handels zur Ostsee und für seine wirtschaftliche Entwicklung mehr und mehr in den Mittelpunkt.
Das große Ringen um Macht und Herrschaft in der OstseeregionÜber Jahrhunderte wurde hier um Macht und Herrschaft untereinander und gegeneinander zwischen Dänemark, Schweden, Deutschland und Polen (Polen-Litauen) und Russland gerungen:
- Der Deutsche Orden, militärisch straff organisiert, eroberte an der Ostseeküste große Gebiete. Das Kolonialreich bestand von 1230 bis 1561 und umfasste in etwa das Gebiet des späteren West- und Ostpreußens und im Baltikum das des heutigen Estland und Lettland (damals Livland genannt). Der Deutsche Ordensstaat wie auch die Ostkolonisation insgesamt begünstigten den Aufstieg der Deutschen Hanse.
- Die Deutsche Hanse beherrschte den Ostseehandel über zwei Jahrhunderte und schloss russische wie andere Kaufleute in dieser Zeit fast völlig vom Handel aus. Nach Blütezeit und beginnendem Abstieg der Hanse wurde der russische („moskowitische“) Außenhandel zunehmend von holländischen und englischen Kaufleuten bis in das 17. Jahrhundert hinein beherrscht. Russland sollte weiter daran gehindert werden, zu einer militärischen und wirtschaftlichen Großmacht aufzusteigen.
- Schweden, Litauen und Polen konnten sich gegenüber Ordensstaat und Ostkolonisation behaupten und selbst nach Finnland bzw. in das von der Mongoleninvasion geschwächte Russland (genauer die „Rus“) hinein expandieren, erleichtert zudem dadurch, dass es politisch schon länger zersplittert war in häufig untereinander verfeindete Fürstentümer. Polen konnte sich zwar gegenüber dem Deutschen Orden behaupten, wurde durch ihn aber für 157 Jahre von der Teilnahme am Ostseehandel bis zum 2. Frieden von Thorn im Jahre 1466 ausgeschlossen.
- Schweden wurde nach Verlassen der konfliktreichen Kalmarer Union (1523) mit Dänemark zum erfolgreichen Rivalen Dänemarks im Kampf um die Ostseeherrschaft, dem Dominium maris baltici. Dänemarks dominierende Rolle in der Ostseeregion ging mit dem Frieden von Roskilde (1658) zu Ende. Es beherrschte lange den Zugang zur Ostsee, den Sund. Der Sundzoll bildete die wichtigste Einnahmequelle der Monarchie. Ungeachtet der Kriege und Konflikte mit Russland blieb Polen wichtigster Gegner Schwedens. Ursächlich bedingt durch verwandtschaftliche und dynastische Verflechtungen folgte daraus eine nur durch zeitlich befristete Waffenstillstände unterbrochenen Ära polnisch-schwedischer Kriege, die insgesamt bis 1660 andauern sollte.
- Das Unionskönigreich Polen-Litauen wurde während des 15. Und 16. Jahrhunderts zum mächtigsten politischen Gebilde des östlichen Europas und reichte von der Ostsee bis weit in die heutige Ukraine hinein. Zu dieser einzigartigen Machtstellung verhalfen Siege gegen den Deutschen Orden und die Schwäche russischer Fürstentümer.
Besonderen Zündstoff für Kriege bildete das Baltikum. Es war mit seinen Häfen und Handelsplätzen sowie der nahen Einmündung der Newa in die Ostsee von strategischer Bedeutung für den Handel nach Westen wie nach Osten mit seinen Zugängen zu nahen russischen Handelszentren (Nowgorod, Pskow) und weiter über Wasserwege und den Dnjepr, das Schwarze Meer bis Byzanz und zur Seidenstraße. Es wurde zum Kriegs- und Aufmarschgebiet für den Deutschen Orden, für Schweden, Polen und Russland. Und die Herrschaft über das Baltikum bildete in der frühen Neuzeit den Schlüssel für das Dominium maris baltici. Vom Baltikum aus starteten die Invasionen Schwedens und des Deutschen Ordens nach Russland. Doch sie scheiterten 1240 an der Newa-Mündung und auf dem Eis des Peipussees 1240. Beide wollten die strategische und wirtschaftliche Kontrolle über den lukrativen Ostseehandel Russlands und dessen Zugang zur Ostsee haben. Schwedens Expansionspolitik ab 1560 und richtete sich erneut nach Osten und beginnt im Baltikum. Wesentlich dafür sind starke wirtschaftliche und fiskalische Interessen am Russlandhandel. Später setzte Schweden – inzwischen zur regionalen Großmacht aufgestiegen – alles daran, Russlands wirtschaftliche und militärische Entwicklung zu behindern. So blockierte es den Zugang Russlands zur Ostsee für fast hundert Jahre von 1617 an bis zu dessen Sieg im Großen Nordischen Krieg im Jahre 1721.
Zwischen 1492 und 1582 führten Moskau und Polen-Litauen bzw. das bis 1561 unter Deutscher Ordensherrschaft stehende Livland insgesamt sechs Kriege gegeneinander. Während der Hälfte dieser Zeit herrschte Krieg, der wechselseitig erbarmungslos geführt wurde. Dementsprechend gestaltete sich jeweils die Wahrnehmung des Feindes. Das im Westen des Kontinents verbreitete Bild vom „asiatischen, barbarischen Russland“ ist in dieser Zeit grundgelegt und entstand an der katholischen Universität Krakau.
Druck erzeugt Gegendruck: Russlands Kriege um Zugang zur OstseeDie jahrhundertelang währenden Behinderungen russischen Handels bis hin zur Blockade des Zugangs zur Ostsee wurden für Russland ein zum Kriege treibendes Motiv. Entscheidend war, endlich an der Ostsee eine Basis für einen unabhängigen Außenhandel zu gewinnen und mit den Einnahmen die wirtschaftliche Modernisierung des Landes und des Militärwesens voranzutreiben. Ab Ende des 15. Jahrhunderts begann deshalb eine ganze Serie von Kriegen unter Iwan III. und Iwan IV. und ihren Nachfolgern für den freien Zugang zur Ostsee. Die Auseinandersetzungen mit Schweden und Polen im Baltikum endeten aber allesamt in Niederlagen.
Erst mit dem Großen Nordischen Krieg von 1700 bis 1720 wendete sich das Blatt. Ein Bündnis bildete sich mit Russland, Polen und Dänemark gegen Schweden. Sie hatten allesamt unter der Expansion Schwedens gelitten. Nach anfänglicher Niederlage des Bündnisses rüstete Russland dann in kurzer Zeit massiv auf und konnte König Karl XII. vernichtend 1709 in der Schlacht von Poltawa schlagen. Der lange Krieg endete zwischen Russland und Schweden mit dem Frieden von Nystad 1721. Schwedens Rolle als Großmacht war gebrochen. Schwedisch-Ingermanland, Estland, Lettland sowie Südkarelien gehörten nun zu Russland. Der Zugang zur Ostsee war dauerhaft gesichert. Russland stieg durch diesen Sieg endgültig zum beherrschenden Akteur in der Ostseeregion auf, gehörte nun zum Kreis der europäischen Großmächte und bestimmte deren Politik zunehmend mit. Gleichzeitig wurde die Ostsee ab dann durch den britisch-russischen Gegensatz beherrscht. Englands Interesse richtete sich darauf, ein Übergewicht Russlands im Ostseehandel zu verhindern.
Napoleons Russlandfeldzug 1812 endet in einer KatastropheDie Ergebnisse der Französischen Revolution von 1789 gerieten immer mehr unter Druck der konservativen Großmächte Österreich, Preußen, Russland und England. Frankreich unter Napoleon Bonaparte nahm deshalb seine frühere Expansionspolitik wieder auf. Der größte Gegner blieb England. Frankreich beherrschte zwar – militärisch hochgerüstet – den Kontinent, konnte aber die englische Vorherrschaft auf See nicht brechen.
Deshalb versuchte Napoleon Bonaparte das Ziel an Land mit einer „Kontinentalsperre“, einer Wirtschaftsblockade, zu erreichen. Doch Zar Alexander I. wollte weder dem Hegemonieanspruch Napoleons folgen noch den Abbruch des Handels mit seinem inzwischen wichtigsten Partner England riskieren. Schwedische Besitz- und Handelsinteressen standen ebenfalls dagegen und Russland wurde sogar militärische Hilfe in Aussicht gestellt. Napoleon versuchte den Zaren deshalb mit einem Feldzug 1812 zum Nachgeben zu zwingen. Seine weit überlegene Armee kam zwar bis Moskau, konnte aber Russland nicht besiegen und der Feldzug endete in einer Katastrophe. Unter den Soldaten aus ganz Europa waren auch über
70 000 Polen. Sie setzten ihre Hoffnungen auf vage und hinhaltende Versprechungen Napoleons zur Wiederherstellung des Staates Polen („Rzeczpospolita“) nach einem Sieg über Russland. Denn Polens Staatlichkeit war durch Russland, Österreich und Preußen mit drei Teilungen in den Jahren 1772, 1793 und 1795 beendet worden. Der einst mächtige Doppelstaat Polen-Litauen war von der Landkarte Europas für 123 Jahre bis 1918 verschwunden und hatte der „polnischen Frage“ Platz gemacht.
Polens Krieg für alte Größe mit der Sowjetunion (1920 – 1921) – Siegfrieden, Lehren und FolgenNach dem Ende des I. Weltkrieges entstand der Staat Polen aus den Trümmern dreier Kaiserreiche. Staatschef Pilsudski akzeptierte die provisorisch festgelegte Curzon-Linie als polnische Ostgrenze nicht. Polen sollte wieder die Größe wie bis 1772 haben und damit wie vor den Teilungen. Das führte zum Krieg mit der Sowjetunion, der 1921 mit dem Frieden von Riga beendet wurde. Er war mit deutlichen Nachteilen für die Sowjetunion verbunden und wurde unter der Bedingung geschlossen, dass sie auf die von Polen beanspruchten Ostgebiete jenseits der Curzon-Linie verzichtete. Mit dem Hitler-Stalin-Pakt wurde die Curzon-Linie als Grenzverlauf wieder festgeschrieben.
Von großer militärischer Bedeutung für die Kriegführung waren die Lehren aus diesem Krieg, der in Militärakademien in Ost wie in West genau studiert wurde. Er wurde als letzte Reiterschlacht geführt, also mit wenigen Waffen, aber äußerst beweglichen Verbänden.
Deutlich wurde, dass Panzer als neues Waffensystem genau dieselbe Art von mobilen Fähigkeiten wie Reiterverbände hatten. Der sowjetische Marschall Tuchatschewski erkannte das als einer der ersten in aller Klarheit. Er begann, Rüstung und Strategie der Roten Armee für die Zukunft auf diese Fähigkeiten hin auszurichten. Er konnte aber seine Arbeiten nicht fortsetzen, da er dem Terror Stalins zum Opfer fiel. Deshalb war Deutschlands Blitzkriegsstrategie anfangs des Russlandfeldzuges mit schnellen, tiefen Vorstößen von Panzerverbänden in Verbindung mit Luftunterstützung so erfolgreich. Entscheidend an der Strategieentwicklung war Panzergeneral Guderian beteiligt, der die damalige Kriegführung genau studiert hatte. Möglicherweise hätte der Krieg gegen die Sowjetunion schon zu Beginn eine andere Wendung nehmen und vielleicht ein kurzer sein können.
Nach Ende der Blockkonfrontation weiter mit Konflikt und GewaltDie Ostseeregion droht erneut zum Kriegsschauplatz zu werden. Die wachsende Militarisierung der gesamten Region kündet davon. Vergessen wird, wie schwer Ostsee und große Teile angrenzender Länder durch beide Weltkriege gelitten haben. Man richtet auch nicht mehr den Blick auf die Schrecken des I. und II. Weltkrieges mit insgesamt fast fünfundsiebzig Millionen Toten, dazu Millionen Verletzten und Vertriebenen, zerstörten Städten, Fabriken und Landschaften. Vergessen, dass das Deutsche Kaiserreich entscheidend zum Kriegsausbruch 1914 beigetragen hat. Verdrängt, dass der Nationalsozialismus mit dem Ostfeldzug im II. Weltkrieg auf die Auslöschung der „slawischen Untermenschen“ zielte – die genozidale Züge aufweisende Leningrad-Blockade war Teil der Strategie – und auf Gewinnung „neuen Lebensraums“ und dessen Ressourcen. Bewusst abgehakt die Erfahrungen und Erkenntnisse nach Ende des II. Weltkrieges aus dem waffenstarrenden Kalten Krieg mit Schritten zu Abrüstung, Entspannung und gemeinsamer Sicherheit. Sie sind nach dem Ende der Blockkonfrontation nicht genutzt und weiterentwickelt worden. Mit der NATO- Osterweiterung seit den 1990er Jahren wurde das legitime Sicherheitsinteresse Russlands übergangen und der lange Weg zu dessen Krieg mit der Ukraine, zu Eskalation statt Entspannung beschritten (Verheugen, Erler, 2024). Das alte Feindbild Russland ist wieder voll entflammt. Und Geschichte wiederholt sich in neuen Formen: jahrzehntelange Zusammenarbeit zur Versorgung mit Öl und Gas ist beendet, ein Pipelinestrang Nordstream- Pipeline durch Sabotage zerstört, umfassende Sanktionspakete zur Strangulierung russischer Wirtschaft sind auf den Weg gebracht. Inzwischen wachsen Kriegsgefahren durch immense Aufrüstungen, fehlende Abrüstungsschritte und die bereits vor Jahren begangenen, einseitigen Kündigungen des ABM- und INF-Vertrages seitens der USA. Der alte Kampf für Frieden, Abrüstung, Zusammenarbeit und Völkerverständigung bleibt weiter auf der Tagesordnung.
-----------
Literatur:
Alexander, Manfred: Kleine Geschichte Polens, Reclam Verlag, Stuttgart 2003; Gitermann, Valentin: Geschichte Russlands Bd 1-3, Europäische Verlagsanstalt, Hamburg 1949;
Hofbauer, Hannes: Feindbild Russland – Geschichte einer Dämonisierung, Promedia Verlag, Wien 2016;
Komlosy, Andrea; Nolte, Hans-Heinrich, Sooman, Imbi (Hg.) Ostsee 700 – 2000. Gesellschaft-Wirtschaft-Kultur, Promedia Verlag, Wien 2008;
Lehnstaedt, Stephan: Der vergessene Sieg. Der Polnisch-Sowjetische Krieg 1919 – 1921 und die Entstehung des modernen Osteuropa, Beck Verlag, München 2019;
Luhmann, Jochen: unveröffentlichter Entwurf für eine Buchbesprechung zu Stephan
Lehnstaedts Buch „Der vergessene Sieg….“, 2020);
Nolte, Hans-Heinrich: Geschichte Russlands, Reclam Verlag, Stuttgart 2024;
Schildhauer, Johannes; Fritze, Konrad; Stark, Walter: Die Hanse, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1981;
Terras, Riho: „Wenn die Russen kommen, schiesst in Estland jeder Baum“, Interview mit Lara Lattek, aktualisiert am 17.6.2025, in: https://www.gmx.ch/magazine/politik/russland- krieg-ukraine/riho-terras-russen-schiesst-estland-baum-41083006; Abruf: 23.6.2025; Topolski, Jerzy: Die Geschichte Polens, Verlag Interpress, Warszawa 1985;
Verheugen, Günter; Erler, Petra: Der lange Weg zum Krieg, Wilhelm Heyne Verlag München 2024.
---------------------------
Detlef Bimboes ist Mitglied im Gesprächskreis Frieden und Sicherheitspolitik der Rosa Luxemburg Stiftung in Berlin
Die reichsten Deutschen – wie sich Macht und Vermögen verteilen
Zur gleichen Zeit, in der die CDU/CSU-SPD-Koalition neue Scheußlichkeiten ausbrütet, um Bürgergeldbezieher noch mehr zu kujonieren, ihnen damit drohen, bei Terminversäumnissen das Bürgergeld um 30% bis zu 100 % zu kürzen, ja selbst die Wohnungskosten nicht mehr zu übernehmen (aber damit wird, laut Merz, "niemand in die Obdachlosigkeit getrieben"), veröffentlicht das Manager Magazin sein alljährliches Sonderheft über den Reichtum in Deutschland: "Die 500 Reichsten Deutschen. Wie sich Macht und Vermögen verteilen."
Scheinbar kritisch (aber durchaus richtig!) schreibt die Redaktion über ihre Reichenliste: "Noch nie war sie so notwendig wie heute. Denn Vermögen bedeutet Macht." Und über die Verteilung von Vermögen und Macht soll mit der Veröffentlichung Transparenz hergestellt werden. Ja, selbst Thomas Piketty ("Das Kapital im 21. Jahrhundert") wird zitiert, der die Debatte um die wachsende Ungleichheit in westlichen Gesellschaften enorm beschleunigt habe.
Festgestellt wird: "Obwohl die deutsche Wirtschaft seit drei Jahren stagniert, gibt es hierzulande… immer mehr Milliardäre" – ihre Zahl stieg von 226 auf 256. Sieht man sich nur die hundert Reichsten an, so hat sich ihr Vermögen seit 2001 (dem ersten Jahr der Reichenliste) von 263 Mrd. Euro auf 758 Mrd. Euro in 2025 fast verdreifacht; das Bruttoinlandsprodukt hat sich im selben Zeitraum "nur" verdoppelt. Damit stieg der Anteil der Top 100 am BIP von 12% auf 17,7%. Und auch seit dem letzten Jahr, mit einer Wirtschaft in der Rezession, ging es "für die meisten der Top 500 auch im vergangenen Jahr vermögensmäßig bergauf" – erfreulich, nicht wahr?
Aber auch eine beunruhigende Frage wird aufgeworfen: "Werden Milliardäre bald höher besteuert?" – "Nicht auszuschließen", lautet die Antwort. Aber gemach: Zwar plädiere die Regierungspartei SPD in ihrem Wahlprogramm dafür, jedoch: "Mit dem Koalitionspartner CDU/CSU dürfte das allerdings kaum umsetzbar sein." Wohl wahr: Wenn es dafür nicht eine breite gesellschaftliche Bewegung unter Einschluss der Gewerkschaften gibt, müssen sich die Superreichen auch in den kommenden Jahren keine Sorgen machen.
Einige Einzelheiten: Der reichste Deutsche ist, wie schon im letzten Jahr, Dieter Schwarz, der sein Geld mit Einzelhandel (Lidl, Kaufland), Entsorgung, IT und Immobilien "verdient", mit 46,5 Mrd. Euro; verdienstvoll vom Manager Magazin ist es, dass bei allen Reichen die Quellen ihrer Vermögen aufgeführt werden. So werden bei den mit 36,5 Mrd. Zweitplatzierten, den Familien Susanne Klatten und Stefan Quandt, nicht nur BMW, sondern auch ihre Beteiligungen an sehr unterschiedlichen Firmen aufgeführt. Die Familie Porsche findet sich nach einem herben Rückgang von knapp 4 Mrd. Euro im Vergleich zum Vorjahr mit 15,5 Mrd. Euro auf Platz 12, die Schäfflers wiederum (Autozulieferer, Maschinenbau), die einen großangelegten Arbeitsplatzabbau durchführen, rückten mit einem Zuwachs von 2,5 Mrd. auf 10,1 Mrd. Euro um einige Plätze nach oben, auf Platz 21. Auch Medienunternehmer wie Mohn (Bertelsmann, Platz 29 mit 7,2 Mrd. Euro Euro), Familie Holtzbrinck (3,3 Mrd., Platz 79), Friede Springer und Mathias Döpfner (Springer Verlag, 2,9 Mrd. Euro und Platz 94) finden sich unter den Milliardären.
"In Deutschland stieg 2024 das Gesamtvermögen der Superreichen um 26,8 Milliarden US-Dollar auf inzwischen 625,4 Milliarden US-Dollar. Neun Milliardäre kamen hinzu, insgesamt seien es jetzt 130. Deutschland (83,5 Mio. Einwohner) hat damit nach den USA (345 Mio. Einwohner), China (1.437 Mrd. Einwohner) und Indien (1.417 Mrd. Einwohner) die meisten Milliardäre." (Oxfam "Bericht "Takers not Makers", 20.1.2025)
Das Magazin stellt fest: "Lange Jahre schien es, als sei Deutschland ein Land des alten Geldes – im Gegensatz etwa zu den USA." Doch seit 2001 tauchen auch Tech-Milliardäre auf wie etwa Dietmar Hopp (Platz 11 mit 15,8 Mrd. Euro) und Hasso Plattner (Platz 9 mit 17,7 Mrd Euro), beide SAP-Gründer.
Familie Kraut, die mit Elektrogeräten ("Bizerba") ein Vermögen von "nur" 450 Millionen scheffelte und damit am Ende der Reichstenliste zu finden ist, hat ihr Mitglied Nicole Hoffmeister-Kraut als Wirtschaftsministerin in die baden-württembergische Landesregierung geschickt. Diese direkte Wahrnehmung von "politischer Verantwortung" ist, im Gegensatz zu den USA, noch (?) ungewöhnlich für die Kaste der Allerreichsten.
"Als schnellster Weg, reich zu werden, gilt gemeinhin das Erben.", schreibt das Manager Magazin. Und bringt als Beispiel für "dumm gelaufen" die Erben von Heinz Hermann Thiele (Knorr Bremse), die bei seinem Tod ein Vermögen von 15 Mrd. Euro erbten; allerdings hatte er juristisch ungenügend vorgesorgt, sodass sie an den Freistaat Bayern (die Erbschaftssteuer ist eine Ländersteuer) 4 Mrd. Euro zahlen mussten. Mit 9 Mrd. Euro und Platz 23 geht es den beiden Töchtern aber wahrscheinlich doch recht gut.
Steuerpolitik im Interesse der SuperreichenSuperreiche und ihre Konzerne profitierten weltweit von Steuersenkungen und großzügigen Ausnahmeregelungen, während die Steuern für Milliarden von Menschen stiegen. In Deutschland spielen Lobbyverbände wie „Die Familienunternehmer e.V.“ und die „Stiftung Familienunternehmen und Politik“ bei der Durchsetzung einer solchen Steuerpolitik eine wesentliche Rolle. Das Ergebnis: Milliardärinnen und Multimillionärinnen zahlen vielerorts weniger Steuern auf ihr Einkommen als der Rest der Bevölkerung.
Gewinne für Superreiche durch steigende KonzernmachtWeitere Vorteile für Superreiche ergeben sich aus der zunehmenden Monopolisierung der Wirtschaft. Einzelne Branchen werden von immer weniger Unternehmen dominiert. Die 20 reichsten Menschen der Welt sind EigentümerInnen oder GroßaktionärInnen von Großkonzernen, von denen viele durch eine marktbeherrschende Stellung so mächtig wurden. Aus Oxfams Bericht zu sozialer Ungleichheit. Milliardärsmacht beschränken, Demokratie schützen.
Die Reichstenliste "bietet Nutzwert für Menschen, die sich professionell mit Hochvermögenden befassen.", schreibt die Redaktion. Aber auch für Menschen, die sich mit einem Gesellschaftssystem nicht abfinden wollen, in dem die Reichsten immer reicher und mächtiger werden, haben diese Sonderhefte mit ihren akribisch zusammengestellten Zahlen und Fakten großen Nutzwert für gewerkschaftliche und politische Arbeit.
„Vertrauenskrise“ des Kapitalismus in Deutschland – doch wem nützt es?
Der „Herbst der Reformen“ zeigt wenig Wirkungskraft: Die eingesteuerten politischen Maßnahmen der Deregulierung, steuerliche Entlastungen für Industrie-Konzerne sowie die Einsparungen für soziale Errungenschaften vermögen es nicht, das verloren gegangene Vertrauen deutscher Unternehmen in die Zukunft aufzuhalten.
Die vom Institut für Demoskopie Allensbach im Auftrag von FTI-Andersch durchgeführte Befragung von 169 Industrieunternehmen, Mitte Oktober 2025, liefert Erkenntnisse des verbreiteten Zukunfts-Pessimismus in Deutschlands zentralen Industrie-Branchen. Ein erheblicher Teil der Firmen (51 %) bezweifelt die eigene künftige Wettbewerbsfähigkeit und prognostiziert Stagnation oder Abschwung im Geschäftsverlauf der nächsten zwölf Monate. Besonders betroffen geben sich die Auto-Zulieferer: 60 Prozent von ihnen sehen keine Chancen mehr, eine Geschäftstätigkeit im boomenden Automarkt China aufzunehmen, und über die Hälfte der Maschinenbauer befürchtet, die derzeit in Teilbereichen noch angenommene Technologieführerschaft bald an internationale Wettbewerber zu verlieren. Unternehmen energieintensiver Sektoren, etwa aus Chemie und Stahl, geben zu 94 Prozent an, eine Verlagerung ihrer Produktionsanlagen ins Ausland ernsthaft in Erwägung zu ziehen.
Globale Unsicherheiten, wirtschafts- und geopolitische Krisen sowie Störungen in den Lieferketten verstärken die Herausforderungen aus Sicht der Betriebe. 83 % der Studien-Teilnehmer berichten von einer deutlich erschwerten Planbarkeit, infolgedessen 63 % ihre Investitionen verschieben.
Die jüngsten Reformmaßnahmen der Bundesregierung werden von den Unternehmen bislang wenig als Erfolgstreiber empfunden und das Zutrauen in eine starke Reform-Politik bleibt aus. (1) Laut der Studie beurteilen 83 Prozent der Unternehmen die Planung der Geschäftsentwicklung der kommenden Monate inzwischen als sehr schwierig und demzufolge verschiebt jeder zweite der Befragten (63 Prozent) anstehende Investitionen.
Der gewählte Studientitel „Deutsche Unternehmen verlieren ihr Vertrauen an die Zukunft“ offenbart anscheinend eine massive „Vertrauenskrise“ im deutschen Industriesektor und führt zu der Annahme, dass die Industriebranche nicht mehr auf die Wirtschaftskraft eines exportlastigen, aber innovations-retardierenden Volkswirtschaft vertraut und den Versprechen der politischen Entscheidungsträger immer weniger Glauben schenkt. Gemeint sind hier die großmannsüchtigen Ankündigungen der aktuellen CDU/CSU/SPD-Regierung, dass im Sinne deutscher konkurrenzfähiger Wirtschaftspolitik jetzt alles besser und der Abstiegssog bald „reformerisch“ gestoppt werde. (2); (3)
Nach Auffassung der mit der Befragung beauftragten Beratungs-Firma FTI-Andersch zeigt die Studie, dass viele Unternehmen selbst zu verantwortende strukturelle Probleme in ihren Geschäftsmodellen hätten und Deutschland nicht nur aufgrund schlechter externer Rahmenbedingungen im internationalen Wettbewerb zurückgefallen sei.
Neben den Beispielen Maschinenbau und Chemie-u. Stahl-Industrie führt die Studie aus, dass es 8 von 10 Firmen der Autozuliefer-Branche nicht gelungen sei, an dem mächtig wachsenden Elektro-Automobilmarkt China teilzuhaben und den Rückgang der Belieferung deutscher Automobilunternehmen dadurch mindestens zu kompensieren.
Einen Ausweg sehen 79 Prozent der Auto-Zulieferer durch die Ausweitung ihrer Tätigkeit in anderen Branchen wie etwa der Energiebranche, der Medizintechnik, der Luftfahrt oder der Bahntechnik und vor allem durch die Ausweitung und Teilhabe an dem in Deutschland sich aufblähenden Rüstungsbereich. Die Aussichten auf eine Teilhabe an den schuldenfinanzierten Rüstungs-Milliarden drängt die Auto- und Zulieferbranche zur Geschäftserweiterung. Eine solche Teilhabe am Bau von Panzern und Drohnen wäre für die Zulieferbranche und Auto-Konzerne eine profitable Erweiterung ihres angestammten Geschäftsfeldes ziviler Fahrzeug-Produktion. (4)
Während führende Wirtschaftsinstitute noch argumentieren, die Rückgänge bei Auftragseingängen, Absatz, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit seien normale zyklische Schwankungen, erkennen inzwischen selbst Vertreter dieser Schulen, dass es sich um strukturelle Krisenerscheinungen handelt. Diese lassen sich nicht mehr durch kurzfristige Reformprogramme, Zugeständnisse an die privatwirtschaftlichen Unternehmen sowie Ausgaben-Kürzungen sozialer Leistungen in das „Lot“ der kapitalistischen Wirtschaftslogik zurückführen, sondern erfordere einen grundlegenden wirtschaftspolitischen und gesellschaftlichen Umbau. (5)
Es handelt sich also um strukturell geprägte Widersprüche, die sich aus den sich verschlechternden Verwertungsbedingungen der spätkapitalistischen Produktionsweise ergeben. So räumt auch die Bundesbank ein, dass die deutsche Wirtschaft in einer längeren Phase verhaltener Wachstumsperspektiven, erforderlicher struktureller Anpassungen und sozialen Verwerfungen stehe. Derartige makrowirtschaftliche Prognosen der Bundesbank, des ifo-Instituts und des Instituts der deutschen Wirtschaft führen aus, dass die Ursachen weit über zyklische Abschwächungen hinausreichen und auf eine mehrdimensionale Strukturkrise hindeuten. Sie legen den Schluss nahe, dass die deutsche Wirtschaft vor einem Übergang zu einem postindustriellen, durch Wohlstandsverluste und Fragmentierung geprägten Entwicklungszyklus stehe. (6) Die Analysen räumen ein, dass ein tiefgreifender Wandel der gesellschaftlichen Reproduktionsbedingungen anstehe, der auf die strukturellen Widersprüche innerhalb der spätkapitalistischen Produktionsweise verweist.
Diese Widersprüche entspringen aus gesellschaftskritischer Sicht aber nicht einzelnen Fehlentwicklungen oder kurzfristigen Marktstörungen, sondern sind den sich verschlechternden Verwertungsbedingungen des Kapitals selbst zuzuschreiben.
Schwindendes Vertrauen der Unternehmen – in was?So betrachtet ist die Aussage der zuvor zitierten Allensbach-/FTI-Studie, dass deutsche Unternehmen eine Phase großen Vertrauensverlusts in ihr eigenes kapitalistische Wirtschaften „durchmachen“, eher als moralischer oder psychologischer Zustandsbericht zu bewerten, der die ideologische Struktur des bürgerlichen Bewusstseins widerspiegelt.
Die eigentliche Grundlage der wirtschaftlichen Stagnation eines Produktionsprozesses wird demgegenüber in der Studie nur als Randnotiz erwähnt, bei dem die Organisation, Steuerung und Zielsetzung der Produktion primär auf die Erzielung von Profit ausgerichtet ist und die wirtschaftliche Verwertbarkeit und maximale Kapitalrendite als Wirtschaftsziel bestimmt.
Besonders für Deutschland ist es in der jetzigen Wirtschaftssituation zutreffend, dass die über Jahre auf Waren-Export basierende Profit-logik zunehmend an ihre inneren und äußeren Grenzen stößt: Globale Märkte sind weitgehend erschlossen, natürliche Ressourcen übernutzt und technologische Rationalisierung führt zu einer Entwertung menschlicher Arbeit in einem Ausmaß, das den Übergang zu neuen Zyklen der Kapitalakkumulation erschwert. Immer größere Mengen an Kapital finden keine hinreichend profitable Anlagemöglichkeit in der Produktion realer Güter, so dass spekulative, renditeträchtige Finanzmärkte die reale Wertschöpfung ersetzen.
Hinzu kommt eine wachsende Diskrepanz zwischen Produktionsvermögen und gesellschaftlichem Bedarf. Während technische Produktivität und globale Lieferketten ein potenziertes materielles Produktionsniveau ermöglichen, bleiben weite Teile der Bevölkerung von dieser Produktivität ausgeschlossen und sie werden von allgemeinen Wohlstandsgewinnen ausgeschlossen. Eine staatliche Nachfragestimulierung durch eine an der Mehrheit ausgerichteten Wirtschaftspolitik würde in erster Linie der Masse der privaten Haushalte als die wichtigsten Nachfrager zugutekommen. (7)
Der Wohlstand für die Bevölkerung stagniertNachdem dies aber weitestgehend ausbleibt, entstehen neue Formen sozialer Prekarität, verschärfte Konkurrenz und Abbau von Arbeitsplätzen sowie eine Übernutzung von natürlichen Ressourcen. (8) Und das BIP, das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf als wichtiger Wohlstandsindikator, stagniert insbesondere in Deutschland. Diese Stagnation bedeutet nicht nur ausbleibendes Wirtschaftswachstum, sondern auch stagnierende Realeinkommen für große Teile der Bevölkerung. Ein kontinuierlicher Anstieg des BIP pro Kopf, der früher Wohlstandsversprechen erfüllte, verweist heute signifikant auf die erreichten Grenzen des wachstumsorientierten Modells.
Im folgenden Schaubild zeigt sich die Wohlstandentwicklung für Deutschland im internationalen Vergleich in den vergangenen 10 Jahren.
Die Ursachen liegen wie oben angeschnitten in der Überakkumulation von Kapital, sinkenden Profitraten und der Verlagerung von Wertschöpfung in spekulative Bereiche, d. h. in Aktivitäten, die nicht unmittelbar zur Produktion von realen Gütern oder Dienstleistungen beitragen, sondern primär auf Finanzgewinne durch Spekulation abzielen (Han del mit Aktien, Anleihen etc. ausgerichtet sind. Der technologische Fortschritt führt gleichzeitig zu Rationalisierung und Arbeitsplatzabbau, ohne dass neue, gleichwertige Beschäftigungsmöglichkeiten entstehen. Der materielle Wohlstand der Lohnbeschäftigten stagniert. Der "Wohlstand" konzentriert sich zunehmend bei Kapitaleigentümern, während die Mehrheit der Bevölkerung von den Produktivitätszuwächsen abgekoppelt wird. Die BIP-Stagnation signalisiert somit eine systemische Krise des Kapitalismus.
Die vorherrschende Unternehmer-Mentalität in DeutschlandDie durch die Allensbach-Studie ermittelte „Vertrauenskrise“ ist dieser Argumentation folgend also nicht in „Mentalitätsproblemen“ der Unternehmer zu suchen, sondern in der inneren Widersprüchlichkeit der kapitalistischen Produktionsweise. Die Denkweise der Unternehmer ist kein persönlicher Charakterzug, sondern spiegelt ein Bewusstsein wider, das aus den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen der Produktion hervorgeht. Sie entsteht nicht im Einzelnen, sondern in jener Ordnung, die Gewinnstreben zur obersten Maxime macht.
Mit anderen Worten: Wenn Unternehmer über schrumpfende Profite und schlechte Verwertungsbedingungen jammern, so wie die Studie es zum Ausdruck bringt, ist dies weniger als ein psychologisches Versagen zu verstehen, sondern vielmehr als eine durch Fakten belegbare Reaktion auf abnehmende Gewinnmöglichkeiten. Das „Jammern“ über schrumpfende Profite spiegelt eher die reale ökonomische Situation wider als eine anfällige psychologische Haltung der Unternehmer.
Es ist die langfristige Tendenz im kapitalistischen Wirtschaftssystem, bei der die Profitrate, also das Verhältnis von Profit zum eingesetzten Kapital, trotz technischem Fortschritt und Produktivitätssteigerungen langfristig abnimmt.
Sollte sich der tendenzielle Fall der Profitrate nicht aufhalten lassen, würde er zu einer unüberwindbaren Grenze der kapitalistischen Akkumulation werden und könnte die Überlebensfähigkeit des Kapitalismus als Wirtschafts- und Gesellschaftssystem gefährden. (Karl Marx); (9)
Und so erklären sich generell die Handlungsoptionen kapitalistischer Unternehmen, Profit-Einschränkungen nach Möglichkeit durch Kosten-Einsparungen, technologische Rationalisierung, Produktionsoptimierungen und Verlagerungen zu kompensieren, was die Zahl der Beschäftigten reduziert und zugleich die gesamtgesellschaftliche Nachfrage senkt. (10)
Der daraus resultierende Nachfragemangel wird in der bürgerlichen Ökonomie als „Konsumzurückhaltung“ gedeutet, während er in Wahrheit Ausdruck der krisenhaften Dynamik der Überproduktion ist. Die strukturelle Perspektivlosigkeit bleibt bei fortgesetztem Personalabbau dabei ungelöst bestehen. Eine wahrhaft echte Perspektive wäre durch den Fokus auf die Aufhebung der Ausbeutung und der Schaffung gesellschaftlicher Produktionsverhältnisse zu sehen, statt auf individuelles Konsumverhalten. (11)
Die politische Rhetorik der aktuellen Bundesregierung verstärkt die „Vertrauenskrise“Die angekündigte Reformoffensive im Herbst durch die Bundesregierung zielt darauf ab, staatliche Aufgaben zurück in private Hände zu überführen und die Arbeitsmärkte zu deregulieren. Diese Maßnahmen werden politisch begleitet mit der Aufforderung an Gewerkschaften und Interessensvertreter der Arbeiterschaft, bei Lohnverhandlungen, Forderungen nach Weihnachtsgeld sich zurückzuhalten, um zum Erhalt von Arbeitsplätzen beizutragen. Gleichzeitig wächst auch der Druck auf die Vertretungen der Beschäftigten, insbesondere der Gewerkschaften, welche sich im Rahmen einer vermeintlichen Tarifpartnerschaft und einem gesellschaftlichen Konsens darauf konzentrieren sollen, die Profitabilität zu gewährleisten, anstatt die gesellschaftliche Reproduktion sicherzustellen.
Die derzeitige Regierungskoalition aus CDU/CSU und SPD übernimmt dabei die Rolle des „ideellen Gesamtkapitalisten“, der die langfristigen Bedingungen für die Kapitalverwertung schafft und absichert. Aber das scheint bei den Unternehmern und Kapital-Verwaltern nicht anzukommen und den Erwartungen nicht zu entsprechen. So betrachtet wird die beschriebene „Vertrauenskrise“ zur ideologischen Frage der fortschreitenden Verwertungsprobleme innerhalb der Kapitalfraktion des in der Studie berücksichtigten Industrie-Sektors.
Festzuhalten bleibt, dass die hier behandelte „Vertrauenskrise“ als eine Erscheinungsform bürgerlicher Ideologie eingeordnet werden kann. Eine Vertrauenskrise ist in der kapitalistischen Vergesellschaftung keine Störung sozialen Zusammenhalts, sondern Ausdruck ihrer strukturellen Widersprüche. Vertrauen wurzelt in einer kapitalistischen Gesellschaft nicht im direkten persönlichen Kontakt, in gemeinsamer Erfahrung oder gegenseitiger Verlässlichkeit, wie es in gemeinschaftlichen Strukturen der Fall wäre. Stattdessen entsteht es durch abstrakte, unpersönliche Mechanismen, über den Markt, über das Geld und über das Eigentum. Menschen vertrauen nicht direkt einander, sondern den Institutionen und Mechanismen des Kapitalismus, die ihre gesellschaftlichen Beziehungen durch Konkurrenz und Profitstreben vermitteln.
Wenn diese Vermittlungen – etwa in Finanz- oder Produktionskrisen – brüchig werden, erscheint der Verlust von Vertrauen als moralisches oder psychologisches Problem, als Versagen einzelner Akteure, Institutionen oder als Brüche im Glauben an den Markt, aber nicht als Folge des kapitalistischen Gesellschaftssystems. Und dadurch überdeckt die Rede von der Vertrauenskrise die eigentliche Ursache: die Instabilität kapitalistischer Vergesellschaftung selbst.
Die Untersuchungsergebnisse der Allensbach-Studie Unternehmer verweisen u. a. auf massiv geplante Produktionsverlagerungen der deutschen Industrie-Unternehmen. Es geht den Unternehmen offensichtlich darum, gezielt Standorte mit günstigeren Steuergesetzen und weniger bürokratischen Hürden im Ausland zu nutzen. Erwartet werden niedrige Körperschaftssteuersätze, Steuervergünstigungen für Investitionen sowie flexible Arbeitsgesetze, um eine merkliche Erhöhung des Nettoprofits realisieren zu können. In der Folge belegen die befragten Unternehmen ihr offen vorgetragenes Interesse am Sozialabbau und an Steuerentlastungen. Die Unternehmerklasse übt (auch) dadurch politischen Druck aus, damit der Standort Deutschland vor allem für sie wettbewerbsfähig bleibt. Die aktuelle Bundesregierung kommt diesen Forderungen mit steuerpolitischen Reformen entgegen, beispielsweise durch Senkung der Körperschaftssteuer und Entlastung bei Stromkosten. Doch für viele Unternehmen erfolgt dies offenbar zu langsam oder ist von ihrer Wirksamkeit für sie zu wenig.
Die Lohnabhängigen in Deutschland tragen die negativen Folgen dieser sich abzeichnenden Strukturverlagerungen; Arbeitsplatzverlust, Lohndruck und die Gefahr von Sozialabbau sind direkte Ergebnisse geplanter und sich vollziehender Auslandsverlagerung der Produktion. Das Kapital nimmt dies in Kauf, da die Sicherung der Profitrate im globalen Maßstab Vorrang vor nationalen sozialen Interessen hat.
-----------------
Quellen:
(2) W. Sabautzki: Reine Klassenpolitik, in Marxistische Blätter,4/2025;
(8) Ulf Immelt: Transformation, Krise, Deindustrialisierung, in Marxistische Blätter, 4/25
(9) https://zeitschrift-luxemburg.de/artikel/der-tendenzielle-fall-der-profitrate/
(11) H. Zdebel: Klassenkampf statt Konsumkritik, in: nd Journalismus von links, 2017
Wer verdient am Krieg?
Kaum ein Industriezweig ist so mächtig und zugleich so unsichtbar wie die Rüstungsindustrie. Während Politikerinnen und Politiker von „Sicherheit“ sprechen und Medien neue Waffensysteme als Fortschritt feiern, arbeitet im Hintergrund ein Netzwerk aus Unternehmen, Banken und Lobbygruppen daran, dass das Geschäft mit dem Krieg weiterläuft. Die Informationsstelle Militarisierung (IMI) hat mit ihrem Beitrag „Überblick zu den Akteuren der Rüstungsindustrie“ eine wichtige Bestandsaufnahme vorgelegt. (1) Auf dieser Grundlage lohnt es sich, genauer hinzusehen: Wer sind die eigentlichen Profiteure, wie ist dieses System organisiert – und warum scheint es in unserer Gesellschaft so selbstverständlich geworden zu sein?
Die Netzwerke des KriegesDie Rüstungsindustrie ist weit mehr als nur Panzer, Raketen und Flugzeuge. Hinter den sichtbaren Symbolen militärischer Macht verbirgt sich ein eng verknüpftes Geflecht aus Herstellern, Zulieferern, Forschungsinstituten, Finanzinvestoren und politischen Entscheidungsträgern. Es gibt die großen Namen – Rheinmetall, Hensoldt, Airbus Defence – aber daneben gibt es unzählige kleinere Firmen, die Sensoren, Software, Elektronik oder Spezialteile liefern (5). Zusammen bilden sie eine internationale Wertschöpfungskette, deren Bestandteile sich über Kontinente verteilen. Ein Waffensystem, das in Deutschland gebaut wird, enthält Bauteile aus Frankreich, den USA oder Südkorea; das Kapital stammt oft aus internationalen Fonds. Krieg ist ein globalisiertes Geschäftsmodell. (2)
Diese globale Struktur hat Geschichte. Schon im Kalten Krieg war die Rüstungsindustrie der Motor eines gigantischen technologischen Wettlaufs. Nach 1990 hofften viele auf eine „Friedensdividende“, auf Abrüstung und zivile Umorientierung. Doch statt Stillstand kam die Umrüstung: Rüstungsfirmen suchten neue Märkte, neue Bedrohungsnarrative, neue Produkte. Aus der klassischen Waffenproduktion wurde ein High-Tech-Sektor, der sich mit Schlagwörtern wie „Cyberabwehr“, „Künstliche Intelligenz“ oder „Drohnen“ neu erfand. Der Krieg modernisierte sich – und mit ihm die Industrie, die davon lebt. (3)
Entscheidend für ihr Überleben war und ist die Politik. Denn ohne staatliche Aufträge gäbe es diese Branche nicht. Regierungen sind ihre besten Kunden. Wenn es um Verteidigungsbudgets geht, wird nicht gespart, sondern investiert. Politikerinnen und Politiker rechtfertigen das mit denselben Argumenten, die sich seit Jahrzehnten bewährt haben: Arbeitsplätze sichern, technologische Souveränität wahren, internationale Verpflichtungen erfüllen (4). Wer dagegenhält, gilt schnell als „unverantwortlich“ oder „naiv“.
Demnach lebt die Rüstungsindustrie nicht vom freien Markt – sie lebt von der Politik. Der IMI-Artikel zeigt deutlich, wie eng Industrie und Politik miteinander verflochten sind. Exportbeschränkungen werden gelockert, Aufträge bevorzugt an nationale Anbieter vergeben, bürokratische Hürden abgebaut. Regierungen präsentieren das als notwendige Maßnahme zur „Sicherheit“, tatsächlich aber dient es oft dazu, wirtschaftliche Interessen zu stabilisieren. Die Branche ist dabei höchst profitabel – nicht, weil sie gesellschaftlichen Nutzen stiftet, sondern weil sie von einem garantierten Absatzmarkt lebt. Solange Staaten aufrüsten, fließt das Geld. (5)
Dass Rüstung kein normales Wirtschaftsgut ist, wird gern verschleiert. Volkswirtschaftlich betrachtet ist sie unproduktiv: Sie erzeugt nichts, was man konsumieren oder wiederverwenden könnte. Ihre Produkte dienen dazu, zu zerstören. Trotzdem gilt die Branche als Wachstumssektor. (6) Sie profitiert von Unsicherheit, von geopolitischen Spannungen, von Kriegen. Jede Krise, jede Eskalation lässt die Aktienkurse steigen. In diesem System ist Frieden kein ökonomisches Ziel, sondern ein Risiko.
Sprache, Macht und TransparenzParallel zur wirtschaftlichen und politischen Verflechtung hat sich ein professionelles Netzwerk etabliert, das die öffentliche Wahrnehmung steuert. Lobbyverbände beraten Ministerien, Think Tanks schreiben Studien über „Sicherheitsbedarfe“, PR-Agenturen polieren das Image. In Medien erscheinen Vertreterinnen und Vertreter der Branche regelmäßig als Expertinnen und Experten, die vermeintlich objektiv erklären, warum Aufrüstung unausweichlich sei. So verschwimmen die Grenzen zwischen Information, Meinung und Interessenvertretung. Je komplexer die Strukturen, desto schwerer fällt es, Verantwortlichkeiten zu erkennen. Wer verdient eigentlich an einem Krieg? Wer liefert, wer genehmigt, wer finanziert? Diese Fragen bleiben oft unbeantwortet, weil sie in einem Geflecht aus Geheimhaltung, technischer Sprache und politischen Phrasen untergehen.
Besonders auffällig ist die Macht der Sprache. Begriffe wie „Verteidigungsgüter“ oder „Sicherheitskooperation“ verwandeln Waffenexporte in etwas Harmloses, beinahe Notwendiges. Rhetorisch wird aus „Aufrüstung“ die „Stärkung der Verteidigungsfähigkeit“, aus „Kriegsgerät“ ein „Beitrag zur Friedenssicherung“. Medienberichte übernehmen diese Vokabeln oft unkritisch. Neue Panzer oder Drohnen werden wie Innovationen im Technikteil präsentiert – es geht um Reichweite, Präzision, Effizienz. Über Ethik, über die sozialen und ökologischen Folgen militärischer Produktion wird selten gesprochen. So entsteht ein Klima, in dem militärische Logik zur Normalität wird. (7)
Doch auch wenn die Rüstungsindustrie ihre Strukturen geschickt verbirgt, ist sie nicht unangreifbar. Die IMI zeigt mit Projekten wie den „Vernetzten Waffenschmieden“, wie viel sich offenlegen lässt, wenn man gezielt recherchiert. (2) Transparenz ist der erste Schritt: Wer die Verflechtungen kennt, kann sie benennen – und kritisieren. Ebenso wichtig ist es, den öffentlichen Diskurs zu verändern. „Sicherheit“ darf nicht länger automatisch „Militär“ bedeuten. Echte Sicherheit entsteht durch Bildung, soziale Gerechtigkeit, Energieunabhängigkeit und internationale Kooperation, nicht durch immer neue Waffenprogramme.
---------------------
(1) https://www.imi-online.de/2025/09/25/ueberblick-zu-den-akteuren-der-ruestungsindustrie/
(2) https://www.rosalux.de/vernetzte-waffenschmieden
(3) https://www.imi-online.de/download/IMI_Handbuch_Ruestung_web.pdf
(4) https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/ruestung-aufschwung-100.html
(5) https://www.dw.com/de/r%C3%BCstungsindustrie-boomt-wer-profitiert-davon/a-73115190
(6) https://taz.de/Wirtschaftlichkeit-von-Aufruestung/!6075375/
-----------------------
Siehe auch isw-report 140 "Die Zeitenwende und der Militär-Industrie-Komplex
Syrien – ein Schauplatz widerstreitenden Ringens um die Neugestaltung des Nahen und Mittleren Ostens
Wenn es um die heutige Neugestaltung der nah- und mittelöstlichen Regionalordnung geht, so bildet Syrien aktuell dafür einen der Hauptschauplätze. Mit dem Sturz von Baschar Al-Assad im Dezember 2024 ist dieses durch die Stellvertreterkriege arg gebeutelte Land nunmehr zu einem Schlüsselglied dabei geworden, auf welcher Grundlage die künftige Ordnung in der Region verfasst sein wird.
Während es für die USA und Israel, namentlich für US-Präsident Donald Trump und Israels Premier Benjamin Netanjahu, anscheinend nahezu selbstverständlich ist, dass die neuen Machtverhältnisse in Syrien dem von ihnen unter beider Ägide angestrebten Neuen Nahen und Mittleren Osten in die Karten spielen; versuchen andere Staaten der Region hingegen, diese Entwicklungen zu nutzen, um eine Regionalordnung zu begründen, die auf fairem Interessenausgleich sowie auf dem Prinzip von Dialog und Diplomatie statt auf einseitigen Sicherheits- und Hegemonieansprüchen basiert.
USA und Israel auf vermeintlichem SiegeszugAus Sicht der USA scheint klar zu sein, dass sie in Syrien gewonnen haben. Der Regime-Change, auf den sie fast ein Jahrzehnt lang gezielt hingearbeitet hatte, (1) ist nunmehr Realität. Das bedeutet für die USA, nach fast sechs Jahrzehnten dezidiert antiwestlicher Ausrichtung syrischer Politik jetzt wieder unmittelbaren Einfluss auf die Politikgestaltung in Damaskus nehmen zu können – zumal die neuen Machthaber sichtlich in ihrer Schuld stehen und sich dementsprechend offen zeigen müssen. Denn sowohl ihre Machtübernahme als auch ihre nachfolgende Anerkennung auf der internationalen Bühne verdanken sie in hohem Maße den USA. Wie sonst wäre es vorstellbar gewesen, dass Personen, die zuvor auf US-Terrorlisten gestanden und auf deren Ergreifung sogar Kopfgelder in Millionenhöhe ausgesetzt worden waren – wie beispielsweise Interimspräsident Ahmed Al-Scharaa noch unter seinem Kampfnamen Al-Julani – sich, ohne je zur Rechenschaft gezogen worden zu sein, als die neuen Hoffnungsträger vor der UNO präsentieren? Ganz abgesehen davon hängt es hauptsächlich von den USA ab, inwieweit die noch gegen Syrien bestehenden, und das Land knechtenden Sanktionen in Gänze aufgehoben werden. Nicht umsonst bemühten sich sowohl Interimspräsident Al-Scharaa als auch Außenminister Asaad Hassan Al-Shaibani während ihres Besuches in den USA und den dabei geführten Gesprächen auf offizieller Ebene – darunter auch im Senat (2) – um eine Aufhebung aller dieser Sanktionen.
Ein wichtiges Anliegen der US-Politik gegenüber Syrien besteht erklärtermaßen darin, dass Syrien die Normalisierung der Beziehungen zu Israel vorantreibt – offenkundig unabhängig davon, welche Politik Israel gegenüber Syrien verfolgt. Weil es letzten Endes um das gemeinsame Ziel geht, die Hegemonie in der Region zu sichern.
Offenbar beabsichtigt Israel, basierend auf seinen Erfolgen auf dem Schlachtfeld und dem darauf gegründeten Dominanzanspruch in der Region, die politische Landkarte Syriens völlig neu zeichnen. Ziel scheint zu sein, die bestehende territoriale Struktur des Landes zu verändern, um – gemäß seinem einseitigen Sicherheitsverständnis – sicherzustellen, dass Syrien künftig keine Bedrohung mehr für Israel darstellt. Statt weiterhin als einheitlicher Staat zu existieren, soll Syrien möglichst in mehrere Entitäten auf der Basis religiöser bzw. ethnischer Merkmale - eine drusische, eine alawitische, eine sunnitische sowie eine kurdische – aufgespaltet werden.
Sicherlich nicht zufällig kursieren neuerdings im israelischen Regierungs-Diskurs frühere zionistische Pläne eines Groß-Israel – wie beispielsweise der Yinon Plan, (3) der in seiner Grundstruktur jener Teilung Syriens in mehrere separate Provinzverwaltungen zu Zeiten der französischen Kolonialherrschaft ähnelt. So ließe sich auch erklären, warum sich Israel ausgerechnet zur Schutzmacht der syrischen Drusen ausgerufen hat. Nach Berichten von Haaretz und Reuters (Mitte September) unterstützt es inzwischen drusische bewaffnete Kämpfer mit Geld, Munition und anderem Kriegsgerät. Ebenso werden die Kurden auch weiterhin dazu ermuntert, ihre Eigenständigkeit gegen Damaskus zu behaupten.
Nicht zuletzt scheint es für Israel darum zu gehen, weiteres syrisches Territorium – mehr oder weniger offiziell – kontrollieren zu können, nachdem es bereits die Kontrolle über die gesamten Golan-Höhen und den Berg Hermon völkerrechtswidrig an sich gerissen hat. Umso mehr wird abzuwarten sein, wie das Sicherheitsabkommen dann tatsächlich aussieht, über welches seit einigen Monaten zwischen beiden Seiten verhandelt wird. Bislang bekannte Eckpunkte lassen darauf schließen, dass Israel seinen Anspruch auf die von ihm 1967 besetzten und 1981 annektierten syrischen Golan-Höhen künftig vertraglich absichern könnte. (4) Bereits während seiner ersten Amtszeit hatte US-Präsident Donald Trump – unter Bruch allen Völkerrechts – die syrischen Golan-Höhen als israelisches Staatsgebiet anerkannt. Ein Verzicht auf dieses Territorium dürfte von der syrischen Gesellschaft allerdings kaum widerspruchslos hingenommen werden.
In seiner Rede vor der UNO verurteilte der syrische Interimspräsident die auch noch nach dem Assad-Sturz am 8. Dezember 2024 beständigen israelischen Angriffe auf Syrien als Bedrohung – nicht nur für sein Land, sondern für die gesamte Region.
Regionalmächte als immer entschlossenerer GegenpartInsbesondere die beiden Regionalmächte Türkei und Saudi-Arabien, die – wenn auch aus unterschiedlichen Gründen – zu den Gewinnern des Assad-Sturzes zählen, versuchen, ihre Positionen hinsichtlich der Syrien-Frage zu nutzen, um Israels Streben nach uneingeschränkter Machtdominanz in der Region entgegenzuwirken. Dies geschieht allerdings jeweils entlang ihrer eigenen Interessen und unter Beibehaltung enger Beziehungen zu den USA, was durchaus teilweise erhebliche politische Spannungen impliziert. Immerhin ist die Türkei NATO-Mitglied, während Saudi-Arabien seit Jahrzehnten in einer strategischen Partnerschaft mit den USA steht.
Für die Türkei, deren Beziehungen zu den neuen Machthabern besonders eng sind – manche Beobachter sprechen von Syrien bereits als einem türkischen Protektorat – steht die Kurdenfrage mit an vorderster Stelle. Die Türkei widersetzt sich jeglicher Abtrennung jener hauptsächlich von Kurden getragenen Autonomen Administration in Nord- und Ost-Syrien (AANES). Ebenso drängt sie auf die Integration der dortigen Kampfeinheiten, der Syrian Democratic Forces (SDF), in die reguläre syrische Armee und fordert eine zügige Umsetzung des am 10. März zwischen der SDF und Damaszener Machthabern unterzeichneten Abkommens. Umso herausfordernder stellt sich dementsprechend für sie das Bestreben Israels dar, die Kurden für die mögliche Realisierung des von Netanjahu bereits positiv goutierten Groß-Israel-Konzepts zu instrumentalisieren zu suchen.
Um dem zu begegnen, intensiviert die Türkei ihre Beziehungen mit Damaskus in allen Bereichen, darunter insbesondere auch auf nachrichtendienstlichem und militärischem Gebiet. Auf der Grundlage des im August zwischen beiden Ländern vereinbarten Militärabkommens will die Türkei insbesondere daran mitwirken, eine einheitliche, reguläre syrische Armee aufzubauen – was gleichfalls Israels Ambitionen auf ein verteidigungsunfähiges Syrien als Nachbarn entgegensteht.
Für Saudi-Arabien, das eine zentrale Rolle als regionale Führungsmacht mit globaler Ausstrahlung anstrebt, ist Syrien schon aufgrund seiner geografischen Lage in der Levante von besonderer strategischer Bedeutung.
Im Mittelpunkt der saudischen Syrien-Politik steht vor allem, das Land politisch und ökonomisch nach Kräften stabilisieren zu helfen. Nicht ohne Eigennutz hat sich Saudi-Arabien vehement für die Anerkennung der neuen Damaszener Machthaber und deren Aufnahme in die arabische Staatenfamilie eingesetzt. Zudem vermittelte es die Kontaktaufnahme zwischen Trump und Al-Scharaa und trug damit wesentlich zu dessen internationaler Reputation bei. Auch auf wirtschaftlichem Gebiet engagiert sich Riad vielfältig für Syrien. Nicht nur hat es zusammen mit Qatar für die syrischen Weltbank-Kredite gebürgt; überdies wurden verschiedene Abkommen im Umfang von Milliarden USD zur Entwicklung wirtschaftlicher Schlüsselindustrien wie zur Trümmerbeseitigung vereinbart.
Ungeachtet aller Interessenunterschiede zwischen der Türkei und Saudi-Arabien auf syrischem Boden besteht indessen ausdrückliches Einvernehmen darüber, die Einheit und territoriale Integrität Syriens in seinem bisherigen Bestand zu bewahren und jeglicher Aufgliederung des Landes in einzelne Entitäten entschieden entgegenzutreten. Ebenso verurteilen beide Staaten das gegenwärtige militärische Vorgehen Israels in der Region.
Vor diesem Hintergrund fällt auf, dass Ankara und Riad – im Kontext der politischen Umbrüche in Syrien sowie des immer aggressiveren Vorgehens Israels – ihre Zusammenarbeit zunehmend auch auf den Sicherheitsbereich ausdehnen. So erhob unlängst der türkische Außenminister, Hakan Fidan, die Forderung nach einem gemeinsamen Sicherheitsmechanismus, der der neben ihnen insbesondere auch Ägypten sowie weitere Staaten der Region einbeziehen soll. Ziel ist es offenbar, eine größere strategische Autonomie zu erreichen und so die entstehende Regionalordnung im Sinne der Prinzipien friedlicher Koexistenz zwischen den Staaten und Völkern des Nahen Ostens aktiv mitzugestalten
---------------------------
(1) Bis dann dahin, wie der US-Botschafter zu Assads Zeiten, Robert Ford, Mitte Mai in einem Gespräch mit dem Baltimore Council on Foreign Affairs ausgeplaudert hat, von einer britischen, mit dem MI6 in Zusammenhang gebrachten NGO angesprochen worden zu sein, aus Al-Julani einen Politiker von staatsmännischem Format machen zu sollen. Ihn also – im Zuge eines Regime-Change der besonderen Art – zu dem heutigen Al-Scharaa werden zu lassen.
(2) So traf sich Al-Shaibani am 19. Mai mit Mitgliedern des Komitees für Internationale Beziehungen beim US-Senat, zum Gespräch über die Dringlichkeit eines stabilen, wirtschaftlich prosperierenden Syriens sowie die daraus resultierende Notwendigkeit der Sanktionsaufhebung. Vgl. dazu https://sana.sy/en/politics/2268352/
(3) Ein Plan, der in den 1980er Jahren vom israelischen Journalisten Oded Yinon entwickelt worden sein soll und der auf die Errichtung zweier sunnitischer Staaten – einen um Aleppo und einen um Damaskus gruppiert –, eines alawitischen Staates entlang der syrischen Mittelmeerküste sowie eines drusischen Staates im Süd-Südwesten Syriens optiert hat und bei dem die Kurden als befreundet ausgewiesen sind
(4) Was unter der Assad-Herrschaft für Israel nicht zu erreichen gewesen ist. So waren gerade daran die einst noch unter der Präsidentschaft von Hafez Al-Assad geführten Verhandlungen über ein Friedensabkommen mit Israel gescheitert.
Das isw trauert um Conrad Schuhler
Mit dem Tod von Conrad Schuhler verliert das isw einen seiner qualifiziertesten Mitarbeiter und langjährigen Vorsitzenden. Conrad hat entscheidend zum Profil des Instituts für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung beigetragen. Hauptanliegen seiner wissenschaftlichen und Forschungsarbeit war die Analyse und das Ergründen der Bewegungsgesetze des globalen Kapitalismus, dazu hat er wichtige Beiträge geleistet. Dabei versuchte er auch immer, Anstöße zu Alternativen zu geben. Conrad sah eine wirksame Gegenbewegung in gleichgerichteten Aktionen von Friedensbewegung, Gewerkschaften und sozialen Bewegungen, national und international. Und in Zeiten, wo andere sich schon resigniert zurückgezogen haben, hat er trotz schwerer Krankheit unermüdlich bis zum letzten Moment weitergearbeitet, nie aufgegeben.
Conrad hat seine Erkenntnisse auf isw-Foren, Friedensratschlägen, Gewerkschaftskonferenzen, vielen Veranstaltungen und in Streitgesprächen zur Diskussion gestellt. Dabei war es sein besonderes Anliegen, mit jungen Menschen die Ideen des Marxismus zu diskutieren.
Conrad war nicht nur der scharfe Analytiker. Wer mit ihm zusammengearbeitet hat, kennt auch seine Wärme, seine Geduld, seinen Humor und seine Streitlust. Er hat Freundschaften gepflegt und Solidarität gelebt. Conrad war ein Beispiel dafür, dass Wissenschaft und Menschlichkeit zusammengehören. Er wird uns fehlen als Mitstreiter, Lehrer und Genosse.
In tiefer Trauer und großer Dankbarkeit.
isw-Redaktion
IAA Mobility 2025: Die Autoindustrie zwischen Niedergang und Konversion
Vom 9.-14. September blockiert die IAA große Teile von München und sorgt für enorme Licht- und Luftverschmutzung. Seit mehr als 100 Jahren wird die Messe vom jeweiligen Kanzler eröffnet. Viele Hersteller meiden inzwischen die Ausstellung, Citrëon, Fiat, GM, Peugeot, Tesla und Toyota verzichten auf einen Auftritt, der Glanz und der Hype sind vorbei, die Absätze sind rückläufig, die Partie is over. Dafür reisen mehr als 100 Aussteller aus China an. Was als „Schaufenster für die Zukunft von Verkehr, Technik und urbanem Leben“ gepriesen wird, ist tatsächlich nur die Verkaufsausstellung der Autohersteller, ein verzweifelter Versuch, das verschwundene Interesse der Menschen an dieser ungesunden Art der Fortbewegung wiederzuerwecken. In der City, im open space ohne Eintrittsgeld geht es um die große Show, in der vor allem Kinder mit dem Autovirus infiziert werden sollen. Dieser open space aber auch, „um Proteste von Autoskeptikern schon im Ansatz einzudämmen.“ (1) Auch Rheinmetall ist nicht auf der Messe, weil die ihren Automotive-Sparte zu Rüstungszwecken umbauen“, wie ein Branchendienst berichtet. (2) Die anderen Projekte, in denen Betriebe der Mobilitätsindustrie zu Rüstungsbetrieben werden sollen, wie das Alstom-Werk in Görlitz oder das VW-Werk in Osnabrück, gehören nicht zum PKW-Bereich oder sind noch in der Entwicklung und deshalb nicht bei der IAA vertreten.
Die Krise der europäischen Autoindustrie ist vielfach beschrieben: Technologisch weit zurück hinter China, falsche Modellpolitik, selbst geschaffene Überkapazitäten und keine strategische Industriepolitik seit vielen Jahren. Selbst in den USA ist der Absatz eingebrochen, Volkswagen hat die Produktion des ID 4 in Chattanooga gestoppt. Das Ansehen des Konzerns ist auch wegen seiner gewerkschaftsfeindlichen Haltung auf dem Nullpunkt. Die Unternehmen haben Milliarden in unsinnigen Projekten versenkt. Mercedes-Chef Ola Källenius warnte jüngst vor einem Kollaps des europäischen Automarkts, sollte das Verbot von Neuwagen mit Diesel- und Ottomotoren ab 2035 bestehen bleiben. Die Regierungen hatten mehrere hochkarätige Kommissionen eingesetzt, die allesamt an der Konkurrenz und den Egoismen der großen Konzerne gescheitert sind. Der Niedergang der Autoindustrie kommt einer Deindustrialisierung nahe, wenn mittelgroße Zulieferbetriebe in kleineren Städten die Produktion verlagern oder beenden. (3) „Jetzt werden die Weichen für das gestellt, was in fünf bis sieben Jahren passiert“, warnt der bayerische IG Metall-Bezirksleiter Horst Ott. „Große Zulieferer verlagern Produktion ins Ausland und hier laufen in absehbarer Zeit die Produktlinien der Werke leer.“ (4) Anders als früher wird auch die Forschung und Entwicklung verlagert. Wenn immer mehr verlagert wird, droht ein Dominoeffekt: Je weniger Industrie, desto unattraktiver wird das Land für die Menschen und desto mehr Verlagerung in andere Regionen. Dann wird ein Dilemma entstehen, das betriebsbedingte Kündigungen zur Folge haben wird, aber dadurch wiederum noch schlimmer wird.
Die Begründungen für die Verlagerungen ist immer die gleiche: Bürokratie, Energiepreise, Lohnkosten und so weiter. Aber wenn man es sich genau anschaut, stimmt es bei keinem einzigen Punkt. In den Autofabriken machen die Lohnkosten weniger als 10 Prozent aus - da sind die Löhne nicht das entscheidende Thema. Stattdessen sind es strategische Entscheidungen der Unternehmen zur Steigerung von Gewinnen, ist es das Streben nach maximalen Profiten – nur darum geht es. Wenn mit der Herstellung und dem Vertrieb von Elektronikteilen oder Autos in der Konkurrenz nur sechs Prozent Rendite erzielt werden, könnten auf den gleichen Anlagen vielleicht auch Granaten oder Panzerwagen ohne Konkurrenz gebaut werden mit einer Rendite von 50 Prozent oder mehr. Auch darüber muss im Zusammenhang mit dem Grundgesetz die Debatte geführt werden: Was bedeuten die Artikel 14 und 15 des Grundgesetzes, was bedeuten das Allgemeinwohl und die Möglichkeit der Vergesellschaftung gegenüber der Gier nach maximalen Profiten.
„Es fehlen Leute mit Courage!“Was selbsternannte Autoexperten langatmig kompliziert erklären, klingt aus dem Mund des Kneipenwirtes, der selbst bei VW am Band gearbeitet hat, leicht nachvollziehbar: „Wenn es Volkswagen schlecht geht, geht es der Tunnelschänke auch schlecht. Es gibt immer weniger Schichten bei Volkswagen. Nachtschichten fast gar nicht mehr. Und jetzt sollen viele Arbeitsplätze wegfallen. Ich weiß nicht, wie es hier weitergehen soll. Die Politiker verkaufen uns für dumm. Dann kommen die Aktionäre. Da geht das ganze Geld hin. Die Volkswagen-Vorstände sind natürlich auch verantwortlich – aber die kommen und gehen. Jetzt gibt so eine Scheißegal-Haltung. Dabei müsste man sich aufbäumen. Aber es fehlen Leute mit Courage. (5)“ Die Profite sind im leichten Rückwärtsgang, was für die Börse und für die Aktionäre natürlich eine Katastrophe ist. Die Umsätze sinken und die Gewinne der deutschen Autoindustrie sind im ersten Halbjahr 2025 schmaler geworden. Die Großaktionäre, die eigentlichen Bestimmer in den Konzernen, zweifeln am Geschäftsmodell. Andererseits gibt‘s Gewinnrücklagen von über 300 Milliarden Euro bei Volkswagen (147 Mrd.), BMW (92 Mrd.) und Daimler (75 Mrd.), die wiederum gewinnbringend angelegt sein wollen. „Von einer echten Krise sind die deutschen Automobilhersteller noch weit entfernt“, sagt Frank Schwope, Lehrbeauftragter an der Fachhochschule des Mittelstands in Berlin. (6). Aber die Großaktionäre von VW und Mercedes haben entschieden und wollen ihr Kapital gewinnbringend in der Rüstungsindustrie anlegen.
Bei der Autoindustrie mit 750.000 Arbeiterinnen und Arbeitern in sogenannten Autoclustern (Stuttgart, Süd-Ost-Niedersachsen, Sachsen, München, Köln), geht es um einen Umbau und einen partiellen Ausstieg – weniger Autos, keine Verbrenner mehr, stattdessen Fahrzeuge für den öffentlichen Verkehr und andere, nützliche Produkte. Summarisch um eine Reduzierung von zunächst um die 50 Prozent an Produktion und Arbeit.
Solch eine industrielle Konversion ist nicht einzigartig, sondern hat in verschiedenen gesellschaftlichen Situationen in vielen Ländern stattgefunden: Vor Kriegen hin zur Rüstung, nach Kriegen wieder weg von der Rüstung. Ganze Industriezweige wie Textil, Uhren und Unterhaltungselektronik sind aus unserem Land verlagert worden. In schwach entwickelten Regionen wurde, staatlich gelenkt, eine neue industrielle Struktur geschaffen wie zum Beispiel in der Oberpfalz, im Bayerischen Wald, in Ostfriesland und Nordhessen. Das Opel-Werk in Bochum wurde als Kompensation für den Wegfall des Bergbaues im Ruhrgebiet errichtet.
Atom und Kohle – Blaupause für die Autoindustrie?Atomstrom wurde inklusive der Uranbeschaffung von 1970 bis 2023 mit 190 Milliarden Euro subventioniert, 17 AKW gebaut. Die Endlagerfrage ist weltweit ungeklärt. Es kamen der Fukushima-Schock 2011, der Atomausstieg und der Ausstieg aus dem Ausstieg. Der Rückbau kostet ca. 100 Mrd. Euro, ohne die Rückholung des Mülls aus dem maroden Bergwerk Asse. Die AKW-Betreiber, die Energieversorgungsunternehmen, zahlen 45 Mrd. Euro, die Restverantwortung liegt beim Staat, also bei den Steuerzahlern. Die Konzerne sind so frech und klagen wegen „entgangener Gewinne“: Die Bundesrepublik Deutschland zahlt 1,425 Mrd. Euro an Vattenfall, 880 Mio. Euro an RWE, 80 Mio. Euro an EnBW und 42,5 Mio. Euro an E.ON/PreussenElektra. „Diese Zahlungen dienen einerseits einem Ausgleich für Reststrommengen, welche die Unternehmen nicht mehr in konzerneigenen Anlagen erzeugen können (RWE und Vattenfall), andererseits dem Ausgleich für Investitionen, welche die Unternehmen im Vertrauen auf die 2010 in Kraft getretene Laufzeitverlängerung getätigt hatten, die dann aufgrund der Rücknahme der Laufzeitverlängerung nach den Ereignissen von Fukushima entwertet wurden.“
KohleausstiegSteinkohle ist 300 Millionen Jahre bzw. Braunkohle ist 50 Millionen Jahre alte Biomasse, die seit 200 Jahren, seit der Industrialisierung, in immer größerer Menge für Energiegewinnung verbrannt wird. Steinkohle wird in Deutschland aus wirtschaftlichen Gründen schon länger nicht mehr gefördert, sondern aus Polen, Südafrika und Australien importiert. Nach großen Protesten der Klimabewegung und aus Gründen von Umwelt-, Klima und Gesundheitsschutz wurde der Ausstieg aus der (Braun-)Kohlegewinnung und -verstromung politisch entschieden – in einer breit zusammengesetzten Kohlekommission. Es wurde der sogenannte Kohlekompromiss vereinbart: Ausstieg innerhalb von 20 Jahren bis 2038. Gleichzeitig wurden für die 20.000 Arbeiterinnen und Arbeiter, für die Regionen und Kommunen der drei Kohlereviere (Lausitz, Mitteldeutschland, Rheinland) 40 Milliarden Euro zur wirtschaftlichen Entwicklung, zur Renaturierung sowie mehr als vier Milliarden Euro zur „Entschädigung“ der Kraftwerksbetreiber eingeplant. Die Mittelverwendung ist undemokratisch, bürokratisch, spärlich und oft nicht zielgerichtet.
Umbau der Autoindustrie – Rüstungsproduktion ist keine OptionEs gibt Beispiele für erfolgreiche betrieblich-gewerkschaftliche Aktionen in der Transformation, denen die frühe Einbeziehung der Arbeiterinnen und Arbeiter gemeinsam ist. In den beiden Autozulieferbetrieben Boge in Simmern und Kessler in Aalen wurde die Produktion umgestellt von Autoteilen auf Teile der Bahn oder der Bahninfrastruktur. (7) Der zuständige Gewerkschaftssekretär im IG Metall-Bezirk Mitte spricht von einem „Friedensvertrag“ und ist zuversichtlich, dass die vereinbarten Punkte eingehalten werden. Damit ist auch ein Arbeitskampf vom Tisch, für den sich die IG Metall gerüstet hatte. Dieser hätte Produktionsunterbrechungen in anderen Automobilfirmen zur Folge gehabt. Das hätte zu einem Schaden von bis zu 30 Millionen Euro pro Produktionstag bei Kunden wie VW oder Audi geführt. (8) Solche Konversion ist unter spezifischen Bedingungen auch möglich in der von VW verstoßenen Tochter in Osnabrück, wenn die Gewerkschaft und der Betriebsrat das in betrieblichen Zukunftswerkstätten beziehungsweise Transformationsräten unter Einbeziehung aller guten Ideen der Arbeiterinnen und Arbeiter einschließlich der Ingenieure und des Standortmanagements vorantreiben.
Die Debatte um Rüstungsproduktion ist voll entbrannt. Milliarden – whatever it takes – sollen für Kriegsproduktion zur Verfügung stehen. Die politische Lösung von Konflikten und Diplomatie sind überhaupt kein Thema mehr. Die Lehren des zerstörten Europas, der bedingungslosen Kapitulation der faschistischen deutschen Wehrmacht und die Erfahrungen der Entspannungspolitik im kalten Krieg scheinen vergessen. Egon Bahr sagte: „In der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte. Es geht um die Interessen von Staaten. Merken Sie sich das, egal, was man Ihnen im Geschichtsunterricht erzählt.“
Die Aktionäre von Rheinmetall, Thyssen-Krupp, Henslod, Diehl, Krauss-Maffei, Heckler & Koch sowie Airbus, aber auch die von VW, Mercedes, Conti und Bosch haben ein Interesse daran, die unbegrenzt frei verfügbaren Rüstungsmilliarden einzusacken. Der Porsche-Piëch-Clan kündigt Investitionen in die Rüstung an, interne Richtlinien bei Bosch wurden so angepasst, dass die Produkte auch für militärische Zwecke verkauft werden können. Das ist aus Sicht vieler Arbeiterinnen und Arbeiter eine Abkehr von den bisherigen Werten der Bosch-Stiftung. Dazu Kriegspropaganda an allen Ecken, im Fernsehen, an der Straßenbahn, vor den Werken der Autoindustrie: „Mach, was wirklich zählt – Jetzt Job fürs Volk wagen.“ Das undenkbare soll denkbar, der Krieg soll vorstellbar und führbar gemacht werden. Der Kontext, der bei einer vernünftigen Entscheidung nicht außer Acht gelassen werden kann: Die Rüstungsmilliarden sorgen für ein paar neue Jobs bzw. als magerer Ersatz für in der zivilen Produktion gestrichene oder verlagerte Jobs. Gleichzeitig fehlen diese Milliarden schon morgen in den nächsten Haushalten von Bund, Ländern und vor allem Kommunen, um die einfachsten sozialen Fragen zu lösen. Aller Erfahrung und Prognosen nach können die verlorenen Jobs in der Autoindustrie nicht annähernd durch Jobs in der Rüstungsindustrie kompensiert werden. Das trifft für das Alstom-Werk in Görlitz, das Conti-Werk in Gifhorn und für das VW-Werk in Osnabrück zu – mehr noch, wenn es um die Werke von VW in Zwickau und Emden, von Ford in Saarlouis und Köln gehen wird.
IG Metall sucht ihre PositionJürgen Kerner, der 2. Vorsitzende der IG Metall, nimmt am 1. September, am Antikriegstag, an einer hochkarätigen Rüstungskonferenz teil – zusammen mit Chefs von Rüstungsbetrieben, Rüstungsberatern, Rüstungsforschern und unter anderem Annette Lehnigk-Emden, der Chefin des Beschaffungsamtes der Bundeswehr. Frau Lehnigk-Emden ist die, die von den Kommunen mehr Unterstützung für die Rüstungsindustrie fordert: "Kommunen sind in der Pflicht, die bürokratischen Hindernisse für die Zeitenwende möglichst gering zu halten", sagte sie ausgerechnet in Osnabrück (NOZ, 16.8.2025). Kerner selbst äußerte sich auf dem letzten Gewerkschaftstag der IG Metall und wies nicht nur auf die Vertretung der Beschäftigten in der Rüstungsindustrie hin, sondern ging weit darüber hinaus: „Ich bin der festen Ansicht, dass wir diese Branche in Deutschland und Europa halten müssen.“ Später sagt er in einer gemeinsamen Erklärung mit dem SPD-Wirtschaftsforum und dem Verband der Rüstungsunternehmen: „2024 ist das Jahr der Entscheidung für die wehrtechnische Industrie in Deutschland. Zwar hebt die Politik ihre Bedeutung für die Sicherheit unseres Landes und Europas hervor. Aber anders als man denken könnte, führt das Sondervermögen Bundeswehr nicht automatisch zur Stärkung der heimischen Industrie.“ (9) Andere Akzente setzen Christiane Benner als Vorsitzende und Hans-Jürgen Urban als Vorstandsmitglieder der IG Metall: Christiane Benner schlägt vor, ein Sondervermögen in dreistelliger Milliardenhöhe aufzumachen für den ökologischen Umbau der Industrie und Urban sagt beim Aktionstag der IG Metall im März 2025: „Unsere Industrie der Zukunft muss ökologisch, sozial und demokratisch sein. … Die Transformation, die wir unterstützen, muss fair und solidarisch sein. Und schließlich: Was soll dieser Überbietungswettlauf bei den Rüstungsausgaben? Wer nur auf Waffen setzt, landet in der Sackgasse eines neuen Rüstungswettlaufs.“ (10)
Die deutschen Autobauer Volkswagen, Mercedes und BMW mit ihren Töchtern hatten zuletzt Gewinneinbrüche verkündet. Dennoch wurden Milliarden an die Aktionäre ausgeschüttet. Bei Volkswagen profitiert hauptsächlich der Porsche-Piëch-Clan, der knapp ein Drittel der Aktien hält, bei BMW fließt die Hälfte der ausgeschütteten 2,7 Milliarden Euro an Stefan Quandt und Susanne Klatten. Das Manager Magazin zitiert Christiane Benner: "Die Probleme einzelner Unternehmen sind unterschiedlich gelagert, aber die Situation für die Industrie und die Beschäftigten ist insgesamt schon prekär.“ Die Absatzzahlen von vor der Corona-Pandemie würden in der EU nicht erreicht. "In der Folge sind Werke nicht ausgelastet, und wir führen harte Auseinandersetzungen darüber, dass Beschäftigte nicht einseitig die Lasten tragen", so Benner. Es brauche Innovationen, aber auch industriepolitische Unterstützung aus Berlin und Brüssel. Zudem seien die Rahmenbedingungen für den elektrifizierten Autoverkehr noch nicht ausreichend. "Kaufanreize, Ladeinfrastruktur, Rohstoffversorgung, Recycling: Das sind die Themen für eine europäische automobile Industriepolitik.“ Die Gewerkschaftsvorsitzende sieht auch hausgemachte Probleme, für die „das Management die Verantwortung übernehmen sollte“. Aktionärinnen und Aktionäre sollten bei der Höhe der Dividenden Abstriche machen, da sie trotz geringeren Gewinnen hohe Dividenden erhalten. „Wir müssen da zusammen durch“, sagt Benner. (11) Diese Position, die Aktionäre sollten sich an der „Sanierung“ beteiligen, wurde schon bei der Auseinandersetzung bei VW Ende 2024 erhoben. Der VW-Chef Blume antwortet belehrend: „Als Investor überlege ich mir, wo mein Geld am besten angelegt ist. Wenn ich den Investoren jetzt erzähle, dass wir ihnen die Renditen kürzen, dann droht ein Vertrauensverlust, Investoren könnten sich zurückziehen. Das muss jeder wissen, der scharfe Einschnitte bei den Dividenden fordert. Wir brauchen gerade jetzt in dieser Phase eine Verbindlichkeit für Investoren, damit sie weiterhin zu uns stehen. (12)“ Zehn Prozent Umsatzrendite sollen es in den nächsten Jahren werden – so haben es die Großaktionäre und das Management entschieden.
Rüstung schafft keine Jobs!Rüstungsproduktion kann für Volkswagen bei seiner eigenen grausamen Entstehungsgeschichte niemals eine Option sein. Das sieht auch der Betriebsrat so: Ein Sprecher des Konzernbetriebsrats erklärt, dass ein Einstieg in die Produktion von Kriegswaffen oder Kampfmitteln aus Sicht der Arbeitnehmervertretung keine Option sei. … „Das hat nicht nur unternehmensstrategische und technologische Gründe, sondern nicht zuletzt auch ethische vor dem Hintergrund der Volkswagen-Unternehmensgeschichte.“ (WAZ, 19.8.2025)
Die Propagandaabteilung des Porsche-Piëch-Clans sieht das ganz anders: Der Kriegsverbrecher Ferdinand Porsche (SS-Oberführer, Vorsitzender der Panzerkommission) sei ein genialer Konstrukteur gewesen und der Reichtum des Clans hierin begründet. Tatsächlich wurde das Unternehmen von den Nazis mit gestohlenem Geld der Gewerkschaften, mit Produktion für die faschistische Wehrmacht und mit brutaler Zwangsarbeit aufgebaut. Treiber dabei neben Ferdinand Porsche sein Schwiegersohn und NSDAP-Mitglied Anton Piëch. Jetzt werden durch den Porsche-Piëch-Clan Autofabriken geschlossen und neue Geldanlagen in der Rüstungsindustrie gesucht: „Die Porsche SE investiert gezielt in Fernbusunternehmen, Drohnentechnik und Software für autonome Lkw …“ (13) Zurück zu den grausamen Wurzeln und wieder Geld machen mit dem Krieg? Der Porsche-Piëch-Clan und die Kopf-ab-Diktatur in Katar, die großen Aktionäre von Volkswagen – vom Land Niedersachsen abgesehen – haben ein Interesse daran, die Profite maximal zu steigern und die frei verfügbaren Rüstungsmilliarden einzusacken. Ihnen geht es weder um Demokratie noch um Menschenrechte.
Wie eine Vielzahl Studien zeigt, führen Investitionen in die Rüstung nicht zum Wirtschaftsaufschwung. Militärausgaben sind aus ökonomischer Sicht keine Investitionen zur Entwicklung der Wirtschaft, sondern „totes Kapital“. Der Multiplikator bei Rüstungsausgaben liegt bei rund 0,5 Prozent. Also ein Euro in Rüstung bedeutet 50 Cent Wachstum. Bei Infrastrukturinvestitionen beträgt der Multiplikator 1,5 und bei Bildung liegt er bei drei. Rüstung zieht Ressourcen aus produktiven Bereichen ab. Wir begeben uns so auf eine ganz schiefe Ebene, auf der es bald kein Halten mehr gibt. Aller Erfahrung und Prognosen nach können die verlorenen Jobs in der Autoindustrie nicht annähernd durch Jobs in der Rüstungsindustrie kompensiert werden. Das trifft auch für das Werk in Osnabrück zu. Vielleicht bleiben ein paar hundert Arbeitsplätze, wenn Rheinmetall einsteigt - aber sich nicht die 2.300 plus Zulieferer, die es heute sind. Andererseits: Der Markt für passende Fahrzeuge für Ridepooling wächst und der Bedarf ist riesig - aber das Geschäft machen dann Holon oder Baidu.
Die Ouvertüre zur Monstermesse in München: Der Sozialstaat ist schuldKurz vor Beginn der IAA drängt die Autoindustrie trotz aller Klimakatastrophen auf eine Abkehr vom sogenannten Verbrennerverbot und eine Abkehr von den CO2-Zielen. Für die Umstellung auf Elektromobilität fordern die Autokonzerne mehr Unterstützung von der Politik. "Wir brauchen ein klares Signal und gezielte staatliche Fördermaßnahmen, um die Skepsis privater Käuferinnen und Käufer abzubauen und die Nachfrage in dieser Gruppe anzukurbeln", sagt ein VW-Vorstand. Derzeit sind es vor allem gewerbliche Kunden, die E-Autos kaufen oder leasen. Vergleichbare Steuervergünstigungen sollen zulasten der Steuereinnahmen auch private Autokäufer erhalten.
Darüber hinaus will die Industrie Reformen „für die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes“ – genau das, was Merz und Klingbeil mit dem „Herbst der Reformen“ jetzt umsetzen wollen: Sozialabbau und Arbeitszeitverlängerung. „Die Unternehmen der deutschen Automobilindustrie sind mit ihren Produkten international wettbewerbsfähig, der Wirtschaftsstandort Deutschland ist es aktuell nicht. Entscheidend ist deshalb, dass Wettbewerbsfähigkeit und Standortattraktivität zur politischen Top-Priorität in Berlin und Brüssel werden. Dabei muss klar sein: Die Industrie braucht mehr als nur Symptombekämpfung, sie braucht zielgenaue Maßnahmen für die Behebung der Ursachen der mangelnden internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Standortes. Berlin und Brüssel müssen die unterschiedlichen Standortfaktoren — u.a. von Energiepreisen, Bürokratiebelastung, Regulierungsausmaß und Rohstoffversorgung — konkret in Angriff nehmen und so die Wettbewerbsfähigkeit stärken. Gerade mit Blick auf die geopolitischen Entwicklungen ist ein wirtschaftlich starkes Europa von zentraler Bedeutung: Nur ein wirtschaftlich starkes Europa hat auf der politischen Weltbühne eine gewichtige Stimme, nur ein wirtschaftlich starkes Europa hat Einfluss auch auf die Gestaltung der Klimaziele und andere wichtige geopolitische Fragen." (14)
----------------
Fußnoten
(2) https://www.automobil-industrie.vogel.de/iaa-mobility-2025-messe-muenchen
(3) Beispielhaft Bosch in Sebnitz: Im kleinen Städtchen Sebnitz in der Sächsischen Schweiz an der Grenze zu Tschechien lässt Bosch Werkzeuge (Power Tools) produzieren und ist der größte Arbeitgeber, allerdings seit Jahren schrumpfend. Die verbliebenen 280 Arbeitsplätze will der Konzern jetzt kündigen und den Betrieb nach Osteuropa verlagern. Die Folgen eines Rückzugs von Bosch aus der Region Ostsachsen sind fatal. Die AfD erhielt in Sebnitz bei der Bundestagswahl 54 Prozent der Zweitstimmen. Die Menschen sind nicht nur von der Arbeit erschöpft und von Angst geplagt, sondern verzweifeln an der Unerbittlichkeit der Konzerne und an der teilnahmslosen Zuschauerrolle, die die Regierungen auf Landes- und Bundesebene einnehmen. https://stephankrull.info/2025/08/19/die-organisierende-klassenpartei-und-die-sozial-oekologische-transformation/
(4) https://www.zeit.de/news/2025-08/15/ig-metall-in-zweiter-welle-droht-verlust-zehntausender-jobs
(5) Wolfsburger Allgemeine, 30./31.8.2025
(7) https://www.sozialismus.de/detail/artikel/panzer-statt-porsche-nein-sagen-genuegt-nicht/
(9) https://www.igmetall.de/presse/pressemitteilungen/verteidigungsindustrie-zukunftsfaehig-machen
(10) https://hans-juergen-urban.de/wp-content/uploads/2025/03/2025_03_15_Aktionstag_Rede_Urban_final.pdf
(12) Braunschweiger Zeitung, 22.1.2025
(13) Berliner Zeitung, 14.8.2025
Die neue Weltordnung und der Hauptwiderspruch im globalen Kapitalismus
Wir leben, sagen uns Politik und Medien, in einer Epoche sich überstürzender Zeitenwenden. Russland überfällt die Ukraine und stürzt die „europäische Nachkriegsordnung“ um und mit ihr die Nachwendeordnung nach der Implosion des realen Sozialismus. Die Nato sieht voraus, dass Russland spätestens Ende der Zwanziger Jahre in der Lage ist, Nato-Europa zu überrennen und legt eine Aufrüstung von 5% der jährlichen Wirtschaftsleistungen fest. Dabei ist die Nato heute schon die stärkste Militärmacht der Welt. 32 Nationen, eine Milliarde Menschen, 9.400 Kampfpanzer, 4.500 Kampfflugzeuge, 3,2 Millionen Personen Truppenstärke, 22.000 Artilleriegeschütze.
Dass die Führer der „westlichen Wertegemeinschaft“ entschlossen sind, ihre militärische Macht auch einzusetzen, haben sie gerade im Nahen Osten bewiesen: Israel bombardierte systematisch zivile Ziele im Iran, die USA ließen bunkerbrechende Raketen – über zehn Meter lang, Tiefenweite über hundert Meter – auf Atomanlagen herabregnen. Ein zunehmend geistesgestörter US-Präsident, ins Amt gedrückt von offen skrupellosen Tech-Monopolisten des Silicon Valley, feiert die Untat als Triumph der Zivilisation und sich selbst als größten Friedenspräsidenten aller Zeiten. Der deutsche Kanzler lobt die Israelis, sie würden „die Drecksarbeit für uns“ machen. Die politischen Eliten der „transatlantischen Gemeinschaft“ rücken die Welt näher an einen Großen Krieg, sie geben Israels Netanjahu nicht nur das Plazet zum systematischen Völkermord an den Palästinensern, sie haben in Europa keine andere Antwort auf die Aggression Russlands als die eigene Hochrüstung und „Kriegsertüchtigung“. In den Ländern des Westens bringen sich „Rackets“ an die Macht, Kapitalgruppen vor allem um High Tech, Rüstung, Energie, die, wie Max Horkheimer diese Klassenfraktionen nannte, als „Beutegemeinschaften“ den Staat und seine Bevölkerung ausnehmen, ohne Rücksicht auf aktuelle Lebensinteressen und Zukunft der Masse der Bevölkerung.
Über hundert Millionen Menschen sind bereits auf der Flucht vor Krieg und Elend. In den noch lebenswerten Regionen der Erde, längst geplagt von jahrelanger Rezession und wachsender sozialer Ungleichheit, fürchten sich noch mehr Millionen vor dem möglichen Zuzug der Fremden. Das Fremde wird zum Anathema in der politischen Diskussion, die eigene Nation und Racket-Herrschaft soll „great again“ werden und bleiben. Wohin treibt es diesen Welt-Kapitalismus? Auch und gerade für Marxisten eine Frage, die womöglich neue Antworten verlangt, jedenfalls neue Aspekte aufwirft.
Die marxistische Diskussion zur Überwindung des Kapitalismus kreiste immer um die Fragen: Wo ist der Hauptwiderspruch im kapitalistischen Widerspruchsfeld zu sehen? Und daraus ableitend: Welches ist die gesellschaftliche Hauptgegenkraft gegen die Kapitalherrschaft, wer ist der Hauptträger der revolutionären Bewegung?
I. Der Marxismus – immer auf der Suche nach dem HauptwiderspruchDie internationale kommunistische Arbeiterbewegung war sich zu Beginn darüber im Klaren und einig, wo der Hauptwiderspruch im Kapitalismus zu suchen sei. Das Kommunistische Manifest von Marx und Engels schließt 1847 mit dem Aufruf: Arbeiter aller Länder, vereinigt euch! Die Arbeiterklasse war der Gegenpol zum Kapital, das sich international organisierte, weshalb auch die Arbeiterklasse dieses internationale Niveau – „aller Länder, vereinigt euch““ – erreichen musste, um im realen Klassenkampf zur revolutionären Kraft zu werden. Die Dritte Internationale beschloss unter dem maßgeblichen Einfluss von Lenin und Trotzki die neue Formel: „Arbeiter aller Länder, unterdrückte Völker, vereinigt euch“. In den kolonialistisch ausgebeuteten Nationen hatten sich Befreiungsbewegungen gebildet, die von der Internationale als gleichberechtigte Elemente der internationalen Widerspruchsfront begrüßt wurden. Stalin änderte diese Schwerpunktsetzung der Internationale. Für den Stalinismus war der „Rote Oktober“ das entscheidende antikapitalistische Signal. Hier, im ersten sozialistischen Land, steckte für Stalin auch die entscheidende antikapitalistische Kraft. Ein erfolgreicher Sozialismus in der Sowjetunion würde die proletarischen Massen weltweit für den Sozialismus begeistern, den Ausbeutungsradius des Kapitalismus verkleinern. Die Unterstützung der SU gehörte ins Zentrum der internationalen Arbeiterbewegung. Noch 1961 formulierte die KPdSU das so in ihrem Programm.
Mit der Implosion des „realen Sozialismus“ erübrigte sich die Kontroverse der Kommunistischen Parteien Russlands und Chinas. Kurzfristig hofften die Kapitalisten auf ein „Ende der Geschichte“ (so Francis Fukuyama, der damalige offizielle Geschichtsphilosoph der US-Regierung), den ewigen Triumph des Kapitalismus, doch mit den von Lateinamerika ausgehenden Finanzkrisen der Neunziger Jahre und dann der globalen Finanzkrise Krise 2007 brach die Krisenhaftigkeit des Kapitalismus mit Kriegen, Einkommensverlusten und Umweltzerstörung wieder heftig auf. In der Corona-Krise 2021 veröffentlichte die International Manifesto Group (IMG) ihr Manifest: „Durch Pluripolarität zum Sozialismus“. Das tödliche Versagen des kapitalistischen Gesundheitssystems hat nach Ansicht der vorwiegend nord- und südamerikanischen WissenschaftlerInnen um die indisch-kanadische Ökonomin Radhika Desai erneut die dringliche Notwendigkeit erwiesen, die Produktion der Essentials des Lebens aus den Händen des Kapitals zu nehmen und in die eines demokratisch organisierten Volks zu überführen. In dieser Frage werden die IMG-Vertreter unter Marxisten auf keinen Widerspruch stoßen. Aber führt der von Hugo Chavez für eine multipolare internationale Ordnung geprägte Begriff der Pluripolarität wirklich zum Sozialismus? Oder überhaupt zum Abbau der Dominanz des Imperialismus? Untersuchen wir die Kräfte, die heute die Hauptelemente der Pluripolarität darstellen. Sind sie Träger eines kämpferischen Widerspruchs zum globalen Kapitalismus? Oder wollen die Eliten vieler dieser Länder nicht eher selbständiger Teil eines globalen Ausbeutungssystems sein und funktionieren dort, wo sie an der Macht sind, auch so?
II. Die neue internationale Ordnung – BRICS hat den Westen überholtSeit den 1980er Jahren galt für die Länder des Globalen Südens der Washington Consensus, die strikte Ausrichtung der Ökonomien dieser Länder an den Interessen der Investoren aus dem Westen. Dem Chefvolkswirt der Investment Bank Goldman Sachs, Jim O`Neil, fiel auf, dass Schwellenländer umso schneller vorankamen, je weniger sie sich an die Vorgaben der kapitalistischen Kommandos aus Weltbank und Internationalem Währungsfonds hielten. Allen voran Brasilien, Russland, Indien und China. Nach Wachstumsraten verlief die Reihenfolge zwar genau umgekehrt, aber O`Neill wollte auf dieses Kürzel hinaus: BRIC. Denn Brick bedeutet im Englischen Baustein und der New Yorker Banker schien zu ahnen, dass auf diesen Backsteinen eine neue Weltordnung entsteht.
2006 gründeten die vier Länder BRIC, seit 2011 nennen sie sich mit dem neuen Mitglied Südafrika BRICS. Mittlerweile haben die BRICS 10 Mitglieder, 11 Partnerländer und über 30 weitere Länder haben ihr Interesse zu Protokoll gegeben. Auch die Türkei hat 2024 einen Aufnahmeantrag gestellt. Allein die 10 offiziellen Mitglieder stellen 48% der Weltbevölkerung und produzieren 40% des Welt-BIP. Die wirtschaftlichen Wachstumsdaten der BRICS liegen erheblich über denen des Westens. In seiner Video-Botschaft an das diesjährige Treffen der BRICS in Rio de Janeiro stellte Russlands Präsident Putin zu Recht fest, das Modell der neoliberalen Globalisierung werde gerade obsolet, der „Schwerpunkt der weltweiten Geschäftstätigkeit“ verlagere sich in die Schwellenländer.
III. Dominante Kraft bei BRICS ist ChinaDas stärkste Element von BRICS ist die Volksrepublik China. Mit 1,4 Milliarden Einwohnern ist sie neben Indien das bevölkerungsreichste Land der Erde, liegt aber mit ihrem kaufkraftbereinigten BIP fast um das Dreifache vor Indien und liegt in der BIP-Weltrangliste nach Kaufkraftparität noch vor der EU und den USA auf Platz 1. China ist längst nicht mehr bloß „die Werkbank der Welt“, sondern nimmt auch in wesentlichen Rohstoffen und moderner Technologie einen Spitzenplatz ein. Bei Seltenen Erden ist ebenso wie bei Lithium, für die Produktion modernster Informationstechnologie unentbehrlich, der Rest der Welt wie bei Kobalt und Mangan auf China angewiesen. An internationalen Patenten für moderne Technologie meldet China neben den USA die meisten an. Im 2. Quartal 2025 erzielte China ein Wirtschaftswachstum von 5,2 % und die Industrieproduktion wuchs um 6,8 %. Die Chinesen konnten den Zollangriff der Trump-USA bisher souverän abwehren.
Höchst bedeutsam ist der akademische Bereich, dem eine eigene Abteilung der in Peking angesiedelten BRICS-Verwaltung zugeordnet ist. Jährlich werden Zehntausende von Studenten und Wissenschaftlern zwischen den Staaten ausgetauscht. Hier entsteht ein Gegengewicht zur „internationalen Klasse“ des Westens. Es entwickeln sich Forscher und Spezialisten ohne den korrumpierenden Einfluss der internationalen Konzerne und sonstigen imperialistischen Agenturen.
Auch hier ist China die Drehscheibe, das mit seiner „Neuen Seidenstraße“ über ein international breit gefächertes Angebot zu internationaler Kooperation in Handel, Verkehr und Wissenschaft verfügt. 65 Länder arbeiten derzeit bei der Neuen Seidenstraße mit, die China auf dem Land- wie auf dem Seeweg handels- und verkehrsmäßig mit Europa verbindet. Die maritime und die landgestützte Seidenstraße betreffen heute mehr als 60% der Weltbevölkerung und 15% der Weltwirtschaft. Der Handel entlang der Seidenstraße umfasst knapp 40% des Welthandels, der Großteil davon entfällt auf den Seeweg. Dies liegt nicht zuletzt am Krieg Russlands gegen die Ukraine, der den Landweg unsicherer und teurer gemacht hat. Am Ende der Kontinentalbrücke China-Europa der Neuen Seidenstraße liegen die Duisburg-Ruhrorter Häfen mit dem Rhein als wichtigster Wasserstraße Europas. Deutschland ist für China und die BRICS eine Region von hoher Bedeutung.
Es ist die Rüstung, in der China dem globalen Widerpart USA erheblich hinterherhinkt. China bringt es auf jährliche Rüstungsausgaben von 374 Milliarden US-Dollar, ein Drittel der Billion die im Jahr von den USA eingesetzt werden. Diese Billion Dollar liegt um ein Drittel höher als die Summe der Rüstungsausgaben, die die BRICS-Länder China, Russland, Indien und Saudi-Arabien zusammen aufbringen. Ohne Russland, das über die stärkste Atommacht der Welt verfügt, wären die BRICS der kriegerischen und nuklearen Erpressung des USA-Westens weithin hilflos ausgesetzt. Der Im Ukraine-Krieg, den Kriegen Israels und Trumps Drohungen gegen Grönland und Panama sowie dem Nato-Aufrüstungsprogramm (5 Prozent des BIP für Rüstung) aufscheinenden Tendenz großer und mittlerer Mächte, die eigenen Interessen wieder kriegerisch durchzusetzen, will China mit verstärkter Aufrüstung der eigenen konventionellen und nuklearen Streitkräfte begegnen.
IV. BRICS ist keine einheitliche Kraft – von den Öl-Dynastien im Nahen Osten über das sozialistische Kuba bis zum Stalin-Verschnitt der Koreanischen VolksrepublikDie BRICS sind alles andere als ein ideologisch geschlossener Verband. Sie reichen von den extrem reichen Öl-Dynastien im Nahen Osten über das sozialistische Kuba bis zur Mullah-Herrschaft im Iran. Was sie eint, ist ihre Gegnerschaft zum globalen Diktat des westlichen Kapitals. Sie zählen auch, die Öl-Reichen arabischen Länder ausgenommen, geschlossen eher zu Fanons „Verdammten dieser Erde“. Nach dem von den UN entwickelten Index menschlicher Entwicklung, der persönliches Einkommen, Gesundheit, Lebenserwartung, Bildung misst, liegt Russland an Nr. 52 der Länderliste, Iran an 76, China an 79, Brasilien an 87, Ägypten an 97, Indonesien an 112 und Indien an 132. Die VAR, ebenfalls BRICS-Mitglied, figuriert an Nr. 26, mitten unter den kapitalistischen Ländern des Westens, wo sie nach dem Treiben des internationalen Finanzkapitals und nach der skrupellosen Ausbeutung des höchsten Ausländeranteils der Erde auch hingehörte. Doch der Staat der Emirate will ein Gegengewicht schaffen gegen das Diktat von Manhattan und London und sieht seine beste Chance in den BRICS.
Gleichzeitig sind sie, die VAR, „Dialogpartner“ bei der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ), einem weiteren regionalen Staatenbündnis, das gegen das Diktat des kapitalistischen Westens in Stellung gegangen ist. Der SOZ gehören an China, Indien, Kasachstan, Kirgistan, Pakistan, Russland, Tadschikistan und Usbekistan. Sie kümmert sich um Handel, Energie und Transport, aber auch – im Zeitalter eines bellizistischen Imperialismus wieder eine entscheidende Frage – um die Gewährleistung und Unterstützung von Frieden und Sicherheit in einer Region, die 40% der Weltbevölkerung umfasst.
Neben der VAR sind u.a. „Dialogpartner“ der BRICS Türkei, Ägypten, Saudi-Arabien, Katar, Bahrain, Kuwait, Myanmar. Die wachsende Entschlossenheit der Entwicklungsländer, sich aus dem Griff des Westens zu befreien, zeigt sich auch in ASEAN, der Association of Southeast Asian Nations, die in Südostasien einen gemeinsamen Wirtschaftsraum nach dem Vorbild der EU schaffen wollen. Ihr gehören an Brunei, Indonesien, Kambodscha, Laos, Philippinen, Malaysia, Myanmar, Singapur, Thailand, Vietnam. Hier zeigen sich zwei Tendenzen. Das internationale Finanzkapital versucht, mit seinem Stützpunkt Singapur einen mächtigen Fuß in die Tür der globalen Neuordnung gerade am Schwerpunkt Pazifik zu bekommen. Und zweitens: Es geht nicht nur um Schutz vor dem West-Kapital, sondern auch, wie im Falle Vietnam, um Selbständigkeit gegenüber China. Je tiefer und vielfältiger die Verbindungen Vietnams zu den Nationen in der Region sind, umso weniger muss sich das Land eventuellen Vorschriften aus China beugen. In der Epoche des De-Coupling können Schwellenländer auch zu Konkurrenten um das Kapital aus dem Westen werden.
Trumps Zollkriegserklärung an 150 HandelspartnerDoch sind nicht nur internationale Handelsbündnisse von Bedeutung für Autonomie und Weltgeltung der Nationen, sondern auch zweiseitige staatliche Handelsabkommen. Die EU verfügt über solche Verträge mit 79 Ländern. Mit Mexico, Chile und den Mercosur-Ländern haben sie neue Verhandlungen begonnen. China, Singapur und Vietnam stehen bevor, mit Japan und Myanmar wird gerade verhandelt. China wickelt 35 % seines Außenhandels über binationale Freihandelsverträge ab, darunter auch mit westlichen Ländern wie Japan, Australien, Schweiz, Neuseeland.
Das wichtigste internationale Handelsland sind nach wie vor die USA. Sie importieren jährlich für 3,1 Billionen Euro die meisten Waren, sie exportieren Güter im Wert von über 2 Billionen Dollar und sind nach China der zweitgrößte Exporteur. Im April 2025 hat US-Präsident Trump die Handelswelt aus den Fugen gehoben, als er ankündigte, die bisher angeblich ungerechten Zölle zu 150 Handelspartnern neu festzulegen, um in Zukunft das die nationale Sicherheit angeblich bedrohende Handelsbilanzdefizit zu vermeiden.
Tatsächlich weisen die USA jährlich seit Jahrzehnten ein gewaltiges Defizit im Warenhandel. auf. Im Dienstleistungsbereich erzielen sie einen Überschuss, der aber mit 72 Milliarden Dollar nur ein Zwanzigstel des Warendefizits ausmacht. Der eigentliche Grund für das permanente Leistungsbilanzdefizit liegt in der Profitkalkulation der Industriekonzerne. Sie verlagern möglichst viele Teile ihrer Produktion ins billigere Ausland, die Schulden ans Ausland können sie mit Hilfe des globalen Dollarregimes wie Inlandsschulden behandeln. Das tut zwar den Konzernprofiten gut, ist aber sehr schlecht für die in der US-Industriegüterproduktion Beschäftigten. Der Anteil der US-Güterproduktion an der Weltgüterproduktion ist von 2001 bis 2023 von 28.4 % auf 17,4 % zurückgegangen. Von 1997 bis 2024 wurden fünf Millionen Arbeitsplätze in der Güterproduktion abgebaut. Für das profitgierige US-Kapital und seine Regierungen war das solange kein Problem, bis die Defizite von Handelsbilanz und Staat – mit 130 % des BIP ist der US-Staat der größte Schuldner der Erde – das internationale Kapital bewogen, sein Geldvermögen nicht mehr bedenkenlos in die USA zu transferieren. Unter den mit Strafzöllen zu belegenden Staaten sind alle G7-Partner der USA. Das Strafzolldiktat mag einzelne Länderbilanzen der USA verbessern, insgesamt schwächt es das West-Kapital.
V. Der Hauptwiderspruch unserer Epoche: Arm gegen ReichDas BIP pro Kopf misst das Bruttoinlandsprodukt eines Landes an seiner Bevölkerungszahl. Es ist mithin keine reale, sondern eine statistische Durchschnittsgröße. Tatsächlich liegen die realen Einkommen der Armen im Globalen Süden wegen der oft miserablen sozialen Kräfteverhältnisse meist noch weit unter diesen statistischen Größen. In der Liste der Länder mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen liegen Finanzoasen, wo das Finanzkapital wegen der minimalen Steuersätze seine Umsätze und Profite versteuert, weit vorne: 1. Luxemburg, 2. Macao, 3. Irland, 4. Singapur, 5. Katar, 6. VAE, 7. Schweiz, 8. San Marino. Ab Nr. 9 beginnt der reale, dort produzierte Reichtum, mit den USA. Unter den ersten 50 Ländern sind alle G7-Länder und weitere West-Metropolen wie Niederlande, Österreich, Schweden, Belgien, Australien, Finnland, Südkorea. Von den Ländern des Globalen Südens außerhalb oder am Rande von BRICS sind nur die Erdölländer Saudi-Arabien, Bahrain, Kuwait unter den ersten 50 der BIP-pro-Kopf-Liste vertreten. Sie können ihre auf ihrem Ressourcenreichtum an Öl und Gas basierende privilegierte Stellung nur halten oder ausbauen, wenn sie auf ein Gegengewicht gegen den Imperialismus des Westens setzen können. Das sehen sie in den BRICS.
Nun erhebt sich die Frage, wie kann ein Konstrukt wie BRICS oder ähnliche Allianzen des Globalen Südens mit höchst unterschiedliche Gesellschaftsregeln der einzelnen Länder die entscheidende Gegenkraft zur globalen Dominanz des West-Kapitals sein. Wir haben die Koreanische Volksrepublik mit einer autoritären Einparteienherrschaft, die noch von Che Guevara als Vorbild für den Globalen Süden angesehen wurde. Wir haben Indien mit der regierenden rassistischen Bharatiya-Janata Partei des Präsidenten Modi. Wir haben an erster Stelle die Volksrepublik China, deren KP als Partei des Volkes firmiert, in der auch die Gruppe der privaten UnternehmerInnen ihren Platz hat. Wir haben das von kapitalistischen Beutegruppen übernommene Russland, das gegen die Ukraine einen Krieg startete, um der von der Nato anvisierten Umzingelung zu entgehen, und nach innen das Gegenteil von sozialistischer Demokratie praktiziert. In den meisten Ländern des Südens erleben wir tiefe demokratische Defizite und extreme soziale Ungleichheit. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass diese Länder wie alle anderen auch fortschrittlichen sozialen Wandel am ehesten durchsetzen können, wenn internationales Kapital daran gehindert ist, sich einzumischen, wann und wo immer es geht. Solange die westlichen Länder ihr „Right to Protect“ praktizieren können, werden sie stets eingreifen, wenn sie ihre Interessen bedroht sehen. Unter dem Vorwand, die Demokratie vor Ort retten zu müssen, haben sie Jugoslawien zerstückelt, Bosnien-Herzegowina weitgehend zerstört, Afghanistan ruiniert, den Irak bombardiert, Libyen eine Epoche zurückgebombt, im Iran macht jetzt Israel „die Drecksarbeit“, wie der deutsche Kanzler anerkennend feststellte. Solange diese Interventionen stattfinden, werden sich demokratische Wechsel, marxistische gar, im Globalen Süden nicht durchführen lassen. Die Änderung der internationalen Ordnung in eine mehrpolige und damit die Chance, die Sonderprofite des West-Kapitals herunterzufahren, ist erste Voraussetzung für eine eigenständige, an den Bedürfnissen des eigenen Volkes orientierte Entwicklung im Globalen Süden.
Übrigens nicht nur dort. Lin Piaos Feststellung aus den 1960er Jahren, der Klassenkampf sei in den Westlichen Industrieländern „vorübergehend“ zum Stillstand gekommen, ist heute gültiger denn je. Waren es damals, im Golden Age des Kapitalismus, vor allem die Zugeständnisse bei Löhnen und Sozialleistungen, die die Arbeiterklasse an der Seite des Kapitals hielten, so treibt sie heute der Unmut über wachsende Armut und Sozialabbau immer weiter nach rechts. Angesichts von über 120 Millionen Flüchtlingen vor Kriegen und Hunger, von denen viele Millionen zu den vermeintlichen Fleischtöpfen des Westens fliehen, verfängt die rechte Propaganda, das Hauptübel in den „Fremden“ zu sehen, von denen nur noch die „Qualifizierten“, die zu den Versorgungs-, Beschäftigungs- und Ausbildungsnöten der West-Länder passen, in diese hereingelassen werden sollen. Die Fremden greifen die geringer werdenden Sozialmittel ab, die Fremden belegen Sozialwohnungen; die Fremden unterbieten mit ihrer Schwarzarbeit bescheidenste Lohnforderungen, die Fremden werden auf den Arbeitsmärkten zu ernsten Konkurrenten – so die rechte Propaganda. In Deutschland ist jeder Fünfte von Armut bedroht, die neu dazu gekommenen Armen sind für sie selbstverständlich ein Problem. Die richtige Lösung wäre: Weg mit den gewaltigen Einkommens- und Vermögensunterschieden in Deutschland; Nein zu Hochrüstung, Ausbau des Sozialstaates inklusive zügiger Ausbau des sozialen Wohnens; konkrete Hilfe gegen globale Armut und Unterentwicklung, sodass es keine Flüchtlinge wegen Hunger und Not mehr geben muss. Das Problem der Armut in Deutschland und anderer West-Länder sind nicht die Fremden, sondern die Reichen im eigenen Land. 0,1 % der Bevölkerung besitzen über 22 % des Gesamtvermögens, während über 27 % überhaupt kein Vermögen bzw. mehr Schulden als Eigenmittel haben. Der von Trump angestachelte Fremdenhass ist Lebenselixier für Multimillionäre wie Trump. Auch das Denken von Friedrich Merz ist hier zuhause. Er war jahrelang Chef der deutschen Abteilung des Wallstreet-Finanzkonzerns Blackrock, dessen bevorzugte Kunden Mitglieder der globalen Plutokratie sind. Die politische Kaste des Westens, die als „Kraft der Mitte“ firmiert, gehört zum eisernen Bestand des modernen Imperialismus, genauso wie die Rechtsparteien, die mit der Ideologie des Fremdenhasses eine neue Rechtfertigung für Privilegien des nationalen Kapitals verbreiten. Das globale Kapital stößt in den West-Staaten auf wenig soziale Gegenkraft. Die rasant wachsende soziale Ungleichheit wird politisch durch die rechte Propaganda aus dem Klassenkampf herausgenommen. Die Linkspartei kann, seitdem sie dies offensiv aufgreift, an Zustimmung gewinnen. Dies wäre der Weg, um auch die Westländer in den Raum des Hauptwiderspruchs im internationalen Klassenkampf zurückzuführen.
Trumps Zollpolitik – Kapitulationserklärung
Geschichte ist nie das Ergebnis des Willens großer Persönlichkeiten – nicht einmal, wenn es sich dabei um ein „very stable genius“ (Donald Trump über Donald Trump) handelt. Es war Marx, der Ende der 1840er und Anfang der 1850er Jahre gegen Pierre-Joseph Proudhon, Victor Hugo und viele andere Anhänger der great men theory die von ihm und Friedrich Engels entwickelte historisch-materialistische Methode auf die Zeitgeschichte anwandte, um zu zeigen, dass historische Strukturprozesse und Klassenkämpfe verantwortlich für Entscheidungen im politischen Überbau und die gesellschaftliche Ideologie sind.
In diesem Sinne ist auch Trumps Zollpolitik weniger ein Trump-, als ein US-amerikanisches Phänomen. Mehr noch: Es war Joe Biden, der die Schutzzölle gegen chinesische E-Autos und Solaranlagen aus Trumps erster Amtsperiode (2017-2021) von 25 auf 100 Prozent vervierfachte. Zudem findet diese Schutzzollpolitik gegen China eine europäische Entsprechung. Die EU beschloss Ähnliches im Herbst vergangenen Jahres.
Die kanadischen Politökonomen Leo Panitch und Sam Gindin haben in ihrem Hauptwerk The Making of Global Capitalism beschrieben, wie der US-Staat den Kapitalismus zunächst im Westen rekonstruierte und in seiner Globalisierung das Mittel erkannte, die rekordverdächtig streikende US-Arbeiterklasse durch eine neue Mobilität des Kapitals erfolgreich zu disziplinieren und zugleich mit Hilfe der Schuldenkrise in den Entwicklungsländern den mehr oder weniger sozialistisch-antiimperialistisch orientierten, nationalen Befreiungsbewegungen das Wasser abzugraben und sie in den westlichen Freihandelskapitalismus zu zwingen. Seitdem sorgte die bloße Androhung von Kapitalverlagerungen in der Regel für Steuersenkungen und Subventionen von Staatsseite und für Zurückhaltung von Seiten der Gewerkschaften. Warum also wird von den USA aufgekündigt, was so lange nach ihren Spielregeln funktionierte und sich in Form von Tributen aus der ganzen Welt – nicht zuletzt in Form von Gewinnen, die sich aus dem Umtausch in US-Dollar ergeben, – für sie bezahlt machte?
Die westliche Kurskorrektur wirft Fragen auf: Ist die Kritik des Freihandels nun rechts? Ist es heute links, ihn zu verteidigen? Die Kritik am Freihandel war und ist eigentlich links. Als am 1. Januar 1994, dem Tag, an dem das Nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA inkrafttrat, der Aufstand der indigenen Guerilla EZLN (Zapatistische Armee für die Nationale Befreiung) im mexikanischen Chiapas begann, läutete dieses Ereignis nur fünf Jahre nach der Verkündung des „Endes der Geschichte“ durch den Politikwissenschaftler Francis Fukuyama, das Ende dieses Endes ein. Die Frage des Subcomandante Marcos – „Wer muss um Verzeihung bitten und wer kann sie gewähren?“ – war der Weckruf für eine aus dem Globalen Süden kommende Bewegung gegen die neoliberale Globalisierung.
Die Globalisierung, die heute per Zollpolitik einseitig beendet zu werden scheint, galt damals als Sachzwang, dem die Nationalstaaten machtlos gegenüberstünden, und dem man sich darum, so das Mantra von neoliberalen Sozialdemokraten wie Bill Clinton, Tony Blair und Gerhard Schröder, von Arbeitgeberverbänden und marktradikalen Stiftungen, nur unterwerfen müsse. Die damalige Kritik wandte sich gegen die Außenwirtschaftspolitik der kapitalistischen Zentren im Westen: Die Globalisierung laufe auf einen informellen Imperialismus hinaus. Tatsächlich hat der Westen die durch die erste (1973) und zweite Ölkrise (1979/80) sowie die radikale Leitzinserhöhung der US-Notenbank (1979) verursachte Schuldenkrise der Entwicklungsländer ausgenutzt: Er knüpfte seine Notkredite an Handelsöffnungen, Deregulierungen und Privatisierungen zugunsten westlicher Konzerne. Eine Politik von Imperien, aber ohne formelle Kolonien.
Das Ergebnis war die vertiefte Abhängigkeit des Globalen Südens und die 100-millionenfache Proletarisierung von Klein- und Subsistenzbauern. Seit 1980 hat sich die globale Arbeiterklasse zahlenmäßig verdoppelt – und zwar weit überproportional zum allgemeinen Bevölkerungswachstum. Das Drama der Weltgeschichte lautet: Kapitalistische Durchdringung führt zu „Überschussbevölkerungen“, weil sie traditionelle Lebensweisen zerstört, ohne ersatzweise einen Platz in der neuen profitgetriebenen Wirtschaft zu bieten. Gegen jene, die auf Suche nach Arbeit und Perspektive den Globalen Süden verlassen, schottet sich der Westen ab: Das Mittelmeer ist ein Massengrab, die US-mexikanische Grenze ein Kriegsgebiet.
Gegen die Freihandelsideologie und für die unabhängige Entwicklung des Globalen Südens entwickelten sozialistische Ökonomen verschiedene Konzepte. Etwa den Panafrikanismus und andere Projekte der regionalen Integration. Oder das von Samir Amin erdachte Konzept des „Delinking“: Länder des Globalen Südens sollen sich bewusst aus der Einbindung in die kapitalistische Weltwirtschaft lösen.
Im Westen konnte man dies lange ignorieren. Dann häuften sich jedoch die periodischen, vertieften Finanzkrisen im globalen Finanzmarktkapitalismus und rückten immer näher ins Zentrum, bis zur Enron- und Dot.com-Krise (2000/2001) in den USA. Damals schlug auch im Westen die Stunde der Globalisierungskritik.
Ist Trump also nun Vorkämpfer dieser Globalisierungs- und Freihandelskritik? Oder ist die Linke heute Verteidigerin einer offenen Globalisierung? In der Arbeiterbewegung lehnte man Schutzzölle traditionell ab: Zum einen, weil sich auch mit Wirtschaft Krieg führen lässt und Handelskriege oftmals Vorboten militärischer Kriege waren. Ein Beispiel ist die Fragmentierung des Welthandels nach 1878, die ins Wettrüsten sowie in die Großmächterivalität um Einflusssphären und koloniale Absatz- und Rohstoffmärkte mündete – begleitet von Nationalismus, Chauvinismus und Kriegsideologie. Zum anderen lehnten marxistische Führungsgestalten wie Clara Zetkin oder Rosa Luxemburg den Schutzzoll ab, weil er die Lebenshaltungskosten für die Arbeiterklasse in die Höhe trieb. Die Handelsschranken zum Schutz etwa der Landwirtschaft sah man Ende des 19. Jahrhunderts als den Versuch, die Profite des Großgrundbesitzes trotz nun globalisierter Agrarmärkte aufrechtzuerhalten – auf Kosten der Arbeiter, für die sich dadurch die Lebensmittelpreise verteuerten.
Ist man also aus einer Arbeiterbewegungs- und Imperialismuskritischen Perspektive gegen Schutzzölle, wenn sie die eigenen starken Staaten im Westen errichten, aber für Schutzzölle, wenn sie den schwachen Staaten erlauben, sich vom Druck des Imperialismus zu befreien? Das ist richtig und zugleich zu einfach gedacht. Denn es war ein zentraler Kern der linken Globalisierungskritik, dass der Nationalstaat keineswegs machtlos und auf dem Rückzug oder gar am Ende sei. Der Kern der bahnbrechenden Analysen der kritischen internationalen politischen Ökonomie im allgemeinen und der von Panitch und Gindin im besonderen, war, dass der Staat bei der Globalisierung des Kapitalismus Pate stand, ja schon immer ihr zentraler Akteur war und ist. Der einzige Staat, der in den Prozessen geschwächt wurde, war der Sozialstaat.
Vor diesem Hintergrund birgt die Freihandelskritik von rechts einen wahren Kern und ist deshalb für Arbeiter und Arbeiterinnen in wettbewerbsschwachen Industrien anschlussfähig. Die rechte Freihandelskritik formuliert im Kern, dass geografische Räume, in denen sich Kapital sammelt, von dieser Tätigkeit profitieren. Das ist auch eine linke Überzeugung. Das Ziel, wieder demokratische Kontrolle über die Ökonomie zu erlangen, ist für alle Weltregionen fortschrittlich.
Allerdings bezieht sich die linke Freihandelskritik weniger auf Warenströme, als auf Kapitalströme, zielt also auf die freie Bewegung des Kapitals, seine „strukturale Macht“. Dies auch, weil der Staat im Kapitalismus unabhängig davon, wer ihn gerade regiert, ein kapitalistischer Staat ist, insofern seine Funktionen über die internationalen Finanzmärkte schuldenfinanziert sind und auf Gedeih und Verderb davon abhängen, dem Kapital ein investitionsfreundliches Klima zu schaffen – sonst droht Investitionsstreik. Die linke Antwort heißt folglich nicht Schutzzölle, sondern Kapitalverkehrskontrollen. Diese sind zum Beispiel in China verschärft worden während die Volksrepublik günstige Handelswaren in die Welt exportierte.
Außerdem verkennt die rechte Freihandelskritik aus Arbeiterperspektive, dass der Wirtschaftsnationalismus à la Biden und Trump zwar ausländische Direktinvestitionen anlocken kann, von denen man sich Jobs und Wachstum verspricht. Alerdings nur unter der Bedingung von Subventionen und schlechten Arbeitsbedingungen: Denn das Kapital geht dorthin, wo es möglichst keine Gewerkschaften, niedrige Löhne und wenig Auflagen gibt.
Hinzukommt, dass die rechte Freihandelskritik verkennt, in welchem Maß die westliche Arbeiterklasse und ihr Lebensstandard von den immer noch recht günstigen Konsumgüterimporten aus China und dem Globalen Süden abhängig sind. Trump wurde von den Arbeitern gewählt, die wütend über die Inflation sind – aber der Handelskrieg wird die Teuerung drastisch verschärfen, ja tut es längst. Auch hier ist linke Kritik da, wo sie schon bei Zetkin, Luxemburg und Co. stand.
Am Ende des Tages verkennt die rechte Freihandelskritik die Qualität des internationalen Handels. Die Leistungsbilanzdefizite der USA sind tatsächlich die Stärke und nicht die Schwäche des US-Imperialismus gewesen.
In einem vom Dollar dominierten Weltsystem vermochten die USA Tribute aus der ganzen Welt abzuziehen, die sie letztlich nicht oder unter Wert bezahlen mussten. Aber genau dies erscheint dem ökonomischen Nationalismus tatsächlich als Verlustgeschäft – mit fatalen Folgen für Weltwirtschaft und Proletariat.
Warum also gehen die USA, warum geht der Westen heute diesen Weg? Wie gut ist China darauf vorbereitet und welche Folgen haben die Reaktionen der Volksrepublik? Die Schutzzollpolitik ist eine ökonomische Kapitulationserklärung. Nachdem die zunehmende Wettbewerbsfähigkeit Chinas in wesentlichen Zukunftstechnologien und bei der Herstellung von Industriegütern die Überlegenheit des chinesischen Staatsinterventionismus über die Austeritätspolitik der USA und der EU offenbart hatte, versuchte die Biden-Regierung mit dem „Inflation Reduction Act“ und dem „CHIPS and Science Act“, und die EU mit ihrem „Green Deal“, „NextGenerationEU“ und dem „EU Chips Act“ sowie Deutschland mit der Umwidmung des Coronafonds in den „Klima- und Transformationsfonds“, China mit seinen eigenen industriepolitischen Waffen zu schlagen.
Es gibt viele Gründe, warum diese Strategien scheiterten. Letztlich hat sich wieder einmal gezeigt, dass es keine Lösungen gibt, die sich aus historisch gewachsenen Kontext einfach adaptieren lassen, und dass auch die erhebliche Rehabilitierung des Staates als Krisenakteur und die Zentralisierung von Entscheidungsfunktionen in den USA und in der EU die staatlichen Planungsressourcen Chinas und seiner Kommunistischen Partei (KPCh) nicht imitieren können. Hinzukommt: Der Neoliberalismus hat sich so tief in die Institutionen, Rechtssysteme, Verfassungen und die gesellschaftlichen Mentalitäten und Ideologien hineingefressen, dass der Versuch der grünkapitalistischen Transformation und Elektrorevolution im Westen daran scheitern musste.
Die Zollpolitik zielt nun nach US-Finanzminister Scott Bessent darauf ab, sich einerseits, wie schon unter Ronald Reagan und Trump 1.0, verbesserte Marktzugänge und Tributgarantien für geistiges Eigentum nicht zuletzt der Silicon-Valley-Techkonzerne zu sichern, andererseits Kapital aus der ganzen Welt mit dem US-Binnenmarkt und lokalen Steuersenkungen und Subventionen anzulocken. Zudem will man den US-Dollar als Weltgeld billiger machen, um auch auf diesem Weg die USA zu reindustrialisieren und das Leistungsbilanzdefizit zu reduzieren.
Dies gilt allerdings alles nicht im Verhältnis zu China. Was gegen andere Staaten als Mittel der Erpressung eingesetzt werden kann, Bessent spricht von einer „Verhandlungstaktik“, ist gegenüber China, dessen Aufstieg die USA regierungsübergreifend verhindern will, Selbstzweck. Das Vorbild ist wiederum Reagan und seine Politik gegenüber dem Hochtechnologierivalen Japan. Ihm gegenüber sorgte die US-Politik für mehrere Jahrzehnte stagnatives Wachstum, ja Deflation. Im Verhältnis zu China aber verkennen die USA die Kräfteverhältnisse und Chinas Vergeltungsmacht.
China hat auf die US-Zollpolitik mit Vergeltungszöllen von 125 Prozent, Ausfuhrbeschränkungen für seltene Erden, von denen die US-Auto- und Rüstungsbranche abhängig ist, Importbegrenzung für Hollywoodfilme, Importstopp für Boeing-Maschinen und spezielle Sanktionen gegen US-Unternehmen reagiert. Die Volksrepublik demonstriert Stärke. Denn die KPCh hat sich mit ihren immensen staatlichen Planungsressourcen systematisch auf diesen Moment vorbereitet. Sicher, die Zollpolitik trifft auch die Volksrepublik hart in einer Situation vergleichsweise niedrigen Wachstums, gestiegener (Jugend-)Arbeitslosigkeit und einer schwelenden Immobilienkrise. Aber es gibt Anzeichen, dass China das bessere Blatt in den Händen hält.
In der Volkrepublik wusste man, was von einer zweiten Trump-Präsidentschaft zu erwarten ist. Die Anti-China-Rhetorik war bereits im Wahlkampf 2016 dominant. Es war der rechtsextreme Medienmacher Steve Bannon, der Trump zur wirtschaftsnationalistischen Politik riet, die China für den industriellen Niedergang der USA verantwortlich macht. Damit entschied Trump die Wahl im sogenannten rust belt für sich. Einmal an der Macht überzog schon Trump 1.0 China mit einem Handelskrieg, der China vom Zugang zu jenen Mikrochips abkoppeln sollte, die es noch nicht selbst produzieren kann oder konnte.
Der chinesische Staat hat auf die Strategien der USA, ihre Vormachtstellung zu verteidigen und den chinesischen Aufstieg einzudämmen, ziemlich erfolgreich reagiert: Die Entscheidung, systematisch in erneuerbare Energien zu investieren und sich von fossilen aus dem Mittleren Osten unabhängig zu machen, stand im Zusammenhang mit dem US-Krieg im Irak, der die globalen fossilen Energieressourcen gegen jegliche Konkurrenten, inklusive der sich osterweiternden EU, sichern sollte. Mit dem elften Fünfjahresplan (2006-2011) begann dann das exponentielle Wachstum in der Gigawattproduktion aus Wind- und Solarenergie. Schon zu Beginn des zwölften Fünfjahresplans (2012-2017) überholte China die USA, zum Ende hin auch Europa. Die Grundlagen der E-Revolution Chinas waren gelegt und damit auch das Fundament für eine Außenwirtschaftspolitik, die sich zunehmend auf die BRICS-Staaten und den Globalen Süden konzentriert und von der einseitigen Abhängigkeit vom US- und EU-Binnenmarkt löst.
Dem militärischen forward positioning von Obama nahm China mit drei Maßnahmen den Wind aus den Segeln: 2012 wird auf dem 18. Parteitag der KPCh die stärkere Entwicklung des Binnenmarkts beschlossen, zu der die Anti-Armutskampagne, die mit insgesamt 770 Millionen Menschen die weltweit größte Einkommensmittelklasse hervorbringt, wesentlich beiträgt. Auch heute sieht die KPCh in der „neuen Urbanisierung“, die einen höheren Individualkonsum nicht zuletzt von öffentlichen Dienstleistungen mit sich bringen soll, ein zentrales Antidot zum US-Handelskrieg. Mit der 2013 beschlossenen Belt and Road-Initiative verlagert China seine Handelswege nicht nur zunehmend nach Eurasien, sondern etabliert sein ökonomisches Modell in diesem Wirschaftsraum. Ebenfalls 2013 eingeleitet wurde der Pakistan-China-Wirtschaftskorridor, mit dem sich die Volksrepublik einen direkten Zugang zum Indischen Ozean jenseits der Meerenge von Malakka verschafft.
Kurz, in China weiß man seit langem, dass die USA alles tun, den chinesischen Aufstieg zu behindern. Und China ist, verglichen mit Japan, weniger verwundbar, insbesondere im Hinblick auf die Mikrochipproduktion. Die nachholende Entwicklung in diesem Bereich reduziert nicht die Abhängigkeit von Importen. Der Anteil an Halbleitern, die China selbst produziert, liegt bei unter zwanzig Prozent. Die „Made in China“-Strategie war diesbezüglich nur bedingt erfolgreich.
Trotzdem hat der jüngste US-Handelskrieg seine Ziele nicht erreichen können: Das chinesische Unternehmen BYD hat Tesla mittlerweile als größter E-Auto-Produzent abgelöst, Anfang des Jahres schockte Deepseek die US-KI-Industrie als effizientere und viel günstigere Alternative zu ChatGPT, und auch der „Chip War“ der USA stößt an seine Grenzen: Die Erfolge von Chinas Mikrochipproduktion waren unerwartet. Huawei legte im August 2023 sein neues Sieben-Nanometer-Modell vor, hinzukommen die, allerdings noch nicht profitablen, aber immerhin erfolgreichen 3 Nanometer-Tests. Auch zeigt auch die Auseinandersetzung um TikTok die Grenzen des US-Staats und seiner Macht auf.
China ist im Unterschied zu Japan in den Achtzigern der weltgrößte Industrieproduzent und die zweitgrößte Wirtschaft mit der größten Mittelklasse der Welt und entsprechend weniger verwundbar. Das Land hat zudem sein eigenes De-Risking betrieben und sich um integrierte Produktions- mit lokalen und sichereren Lieferketten bemüht. In der Solarproduktion etwa ist man bei annähernd hundert Prozent.
In den letzten Jahren hat China außerdem seine Abhängigkeit vom US-Binnenmarkt als „consumer of last resort“ reduziert: Nicht einmal mehr 15 Prozent der Exporte gehen noch in die USA, ein Großteil geht heute in den globalen Süden. Gegenwärtig laufen weitere Maßnahmen zur Stärkung des Binnenkonsums.
Das chinesische Selbstbewusstsein resultiert letzten Endes aus dem Wissen, dass die USA bluffen. Dem Rest der Welt präsentiert sich China wiederum als verlässlicher kooperativer Handelspartner auf Augenhöhe, der auch kleineren und schwächeren Staaten mit Respekt begegnet, niemals Kolonialreich war, trotz seines Aufstiegs keine Kriege führt.
--------------------
Ingar Solty ist Referent beim 31. isw-forum am 29. November 2025
Erstveröffentlichung: konkret 06/2025
Das Internet der Monopole
Die digitale Transformation hat ein Marktgefüge hervorgebracht, das von einigen wenigen Plattformen dominiert wird. Plattformunternehmen wie Alphabet (Google, YouTube), Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), Amazon, Apple und auch Microsoft kontrollieren heute zentrale Infrastrukturen des globalen Wirtschaftens. Während Microsoft vor 20 bis 30 Jahren als der übermächtige Akteur galt – mit Windows als quasi unverzichtbarem Betriebssystem und Office als Standardsoftware –, steht das Unternehmen heute zwar immer noch für zentrale Basis-Infrastruktur (Betriebssysteme, Cloud-Dienste), aber weniger im Zentrum der plattformgetriebenen Monopolstrukturen.
Einst galten all diese Big Tech Konzerne als Wegbereiter für Innovation, Teilhabe und offene Märkte. Heute ist die Realität durch extreme Konzentrationsprozesse geprägt. Empirische Messungen belegen, dass die Nutzung des deutschen Internets mit einem Gini-Koeffizienten von 0,988 nahezu vollständig ungleich verteilt ist – ein Wert, der faktisch einem Monopol gleichkommt (1). Das bedeutet nicht, dass fast alle denselben Browser nutzen, sondern dass sich der gesamte Datenverkehr (Traffic, also die Ströme an Abrufen und Zugriffen im Netz) auf wenige Domains konzentriert: Mehr als 99 Prozent der registrierten Domains in Deutschland verzeichnen keinerlei nennenswerte Nutzung (2).
Diese Machtkonzentration stellt eine demokratiepolitische Bedrohung dar, da zentrale Mediengattungen in der Hand weniger Akteure liegen. Zugleich hat sie tiefgreifende ökonomische Implikationen, denn das Fundament digitaler Marktkonzentration bilden Netzwerkeffekte. Je mehr Nutzer:innen eine Plattform anzieht, desto wertvoller wird sie für weitere Nutzer:innen und Anbieter:innen. Google ist hierfür das Paradebeispiel: Mit einem Marktanteil von 88 Prozent bei Suchmaschinen (3) bietet es den umfassendsten Index, wodurch alternative Anbieter wie Ecosia oder DuckDuckGo faktisch kaum relevant bleiben.
Die Plattformen nutzen diese Mechanismen gezielt, indem sie zunächst mit niedrigen Preisen oder kostenlosen Diensten locken, um später nach Erreichen einer kritischen Masse die Konditionen sukzessive zu verschlechtern. Amazon etwa akzeptierte in den Anfangsjahren massive Verluste, um Händler und Kunden zu binden. Mit wachsender Dominanz erhöhte das Unternehmen Gebühren, bevorzugte systematisch eigene Marken und machte Sichtbarkeit im „Marketplace“ von kostenpflichtigen Zusatzleistungen abhängig. (4) Cory Doctorow beschreibt diesen Prozess als „Enshittification“: Plattformen beginnen nutzerfreundlich, verschlechtern dann das Angebot für Produzent:innen und am Ende auch für Konsument:innen. Am Ende bleibt für alle (außer Amazon) nur noch das Schlechte. (5)
Der digitale Werbemarkt als ökonomisches NadelöhrBesonders gravierend zeigt sich die Machtstellung von Big Tech im digitalen Werbemarkt. Alphabet, Meta und Amazon vereinen zwischen 80 und 90 Prozent der Werbeeinnahmen auf sich. (6) Für tausende übrige Medienunternehmen bleiben lediglich 10 bis 20 Prozent. Dementsprechend kontrollieren Plattformen nicht nur Inhalte, sondern auch den Zugang zu Märkten. Der gesamte digitale „Sales Funnel“ – von der Aufmerksamkeit (Social Media, YouTube), über die Suche (Google), bis zur Transaktion (Amazon) – ist von Monopolen besetzt. (7) Diese Stellung erlaubt es den Plattformen, Preise und Konditionen nahezu beliebig zu diktieren.
Hinzu kommt die Praxis der Selbstbevorzugung. Messungen zeigen, dass Alphabet-Dienste doppelt so häufig auf eigene Angebote verweisen, wie es einem fairen Marktanteil entspräche; bei Meta ist der Effekt noch ausgeprägter. (8) Anstatt Traffic neutral zu verteilen, leiten die Plattformen ihn systematisch in ihre eigenen Ökosysteme. Amazon bevorzugt seine Eigenmarken und zwingt Händler:innen in ein undurchsichtiges System von Gebühren und Werbezuschlägen. Ein vergleichbarer Mechanismus zeigt sich bei Google, das seine eigenen Dienste in den Suchergebnissen systematisch bevorzugt. Für diese Form der Selbstbevorzugung wurde das Unternehmen von der Europäischen Kommission bereits mit milliardenschweren Kartellstrafen belegt.
Dementsprechend wirkt die Dominanz von Plattformunternehmen in doppelter Richtung: als Monopol gegenüber Konsument:innen und als Monopson gegenüber Produzent:innen. Monopson bedeutet: ein Markt mit nur einem dominanten Nachfrager. Anbieter:innen, Autor:innen oder Musiker:innen stehen also einem „Ein-Abnehmer-Markt“ gegenüber. YouTube etwa schüttet nur 55 Prozent der Werbeeinnahmen an sogenannte Content-Creator (Personen, die Inhalte für Plattformen produzieren, z. B. YouTuber:innen) aus, während klassische Vermarkter im Rundfunk mit 10 bis 20 Prozent auskommen. (9) Autor:innen oder Musiker:innen sind noch stärker von wenigen Gatekeepern (Torwächtern, die den Zugang zu Nutzer:innen kontrollieren) abhängig, etwa Amazon im Buchmarkt oder Spotify im Musikmarkt. Mit der Einführung generativer Künstlicher Intelligenz (KI) verschärft sich diese Asymmetrie zusätzlich: Plattformen können künftig Inhalte selbst erzeugen und damit die Rolle externer Produzent:innen weiter marginalisieren. (10)
Dieses Zusammenspiel aus Monopol- und Monopsonmacht ermöglicht es den Plattformen, sowohl auf der Nachfrageseite (durch schlechtere Konditionen für Konsument:innen) als auch auf der Angebotsseite (durch niedrige Vergütung für Produzent:innen) überproportionale Gewinne abzuschöpfen.
Der Mythos der Effizienz und wirtschaftspolitische KonsequenzenVertreter:innen der Chicago School wie Robert Bork haben Monopole traditionell verharmlost: Solange Verbraucher:innen von niedrigeren Preisen profitieren, seien sie ökonomisch unproblematisch. (11) Auf den ersten Blick scheinen digitale Dienste wie Google oder Facebook diesem Kriterium zu entsprechen, da ihre Nutzung kostenlos ist. Doch dieser Eindruck täuscht.
Tatsächlich zahlen die Nutzer:innen nicht mit Geld, sondern mit ihren Daten und ihrer Aufmerksamkeit. Ökonomisch betrachtet handelt es sich um mehrseitige Märkte, in denen die scheinbare Gratisnutzung durch eine extreme Preissetzungsmacht auf der anderen Seite kompensiert wird. (12) Digitale Plattformen behalten zwischen 45 und 100 Prozent der Werbeerlöse ein, während klassische Vermarkter lediglich 10 bis 20 Prozent beanspruchen. (13) Von Effizienz kann hier keine Rede sein – vielmehr zahlen Unternehmen und Produzent:innen im digitalen Ökosystem erheblich höhere Preise.
Die daraus resultierenden Dynamiken machen deutlich: Digitale Netzwerkeffekte führen systematisch zu Konzentration und verhindern faktisch Markteintritt. Klassische Instrumente des Kartellrechts greifen hier kaum. Eine zukunftsfähige Wirtschaftspolitik müsste deshalb konsequent auf strukturelle Regulierung setzen. Dazu gehören: die Durchsetzung von Interoperabilität (technische Anschlussfähigkeit unterschiedlicher Dienste) und offenen Standards – ähnlich wie im E-Mail-Markt, der trotz dominanter Anbieter bis heute Vielfalt ermöglicht (14); ein Verbot der Selbstbevorzugung in Suchmaschinen und digitalen Marktplätzen; die Regulierung von Plattformen als Inhalteanbieter:innen, anstatt sie weiterhin als „neutrale Intermediäre“ zu behandeln; sowie die Einführung von Obergrenzen für Marktanteile, wie sie das Rundfunkrecht mit einer 30-Prozent-Schwelle bereits vorsieht. (15)
Plattformunternehmen haben Strukturen geschaffen, in denen Wettbewerb systematisch blockiert wird. Die Folgen reichen weit über einzelne Branchen hinaus: Sie betreffen den Journalismus ebenso wie die Kreativwirtschaft und führen zu einer gefährlichen Abhängigkeit der Gesamtökonomie von wenigen privaten Akteuren. Die Kritik an Big Tech ist daher keine theoretische Debatte, sondern eine fundamentale Frage nach der Zukunft unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung.
----------------
Literatur
- Andree, Martin / Thomsen, Timo (2020): Atlas der digitalen Welt. Frankfurt a.M.: Campus.
- Andree, Martin (2023): Big Tech muss weg! Die Digitalkonzerne zerstören Demokratie und Wirtschaft – wir werden sie stoppen. Frankfurt a.M.: Campus.
- Bork, Robert H. (1993). The Antitrust Paradox (zweite Ausgabe). New York: Free Press.
- Doctorow, Cory (2023): „Tiktok’s enshittification“. In: Wired, 23. Januar 2023.
- Morozov, Evgeny (2011): The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom. New York: PublicAffairs.
- Calvano, Emilio / Polo, Michele (2021): „Market Power, Competition and Innovation in Digital Markets: A Survey“. In: Information Economics and Policy 54, 1–18.
------------------
(1) Andree/Thomsen 2020; vgl. auch Andree 2023, S. 96.
(2) DENIC 2022, zitiert in Andree/Thomsen 2020.
(3) Andree/Thomsen 2020, S. 29ff.
(4) Andree 2023; vgl. Fallstudie Amazon in Das Internet der Monopole.
(5) Doctorow 2023.
(6) Hagey/Vrancia 2021; Adgate 2021; Ebiquity 2022, zitiert in Andree 2023.
(7) Andree/Thomsen 2020, S. 200–230.
(8) Andree 2023; empirische Nachweise in The Hunger Games.
(9) Andree 2023, S. 149ff.
(10) Andree 2023; vgl. Diskussion in Das Internet der Monopole.
(11) Bork 1993,
(12) Anderson, Simon P. / Jullien, Bruno (2016): „The advertising-financed business model in two-sided media markets“. TSE Working Paper 16–632.
(13) Andree 2023; empirische Analysen in Das Internet der Monopole.
(14) Andree/Thomsen 2020; vgl. auch The Hunger Games.
(15) Rundfunkstaatsvertrag, § 26. https://lxgesetze.de/rstv/25