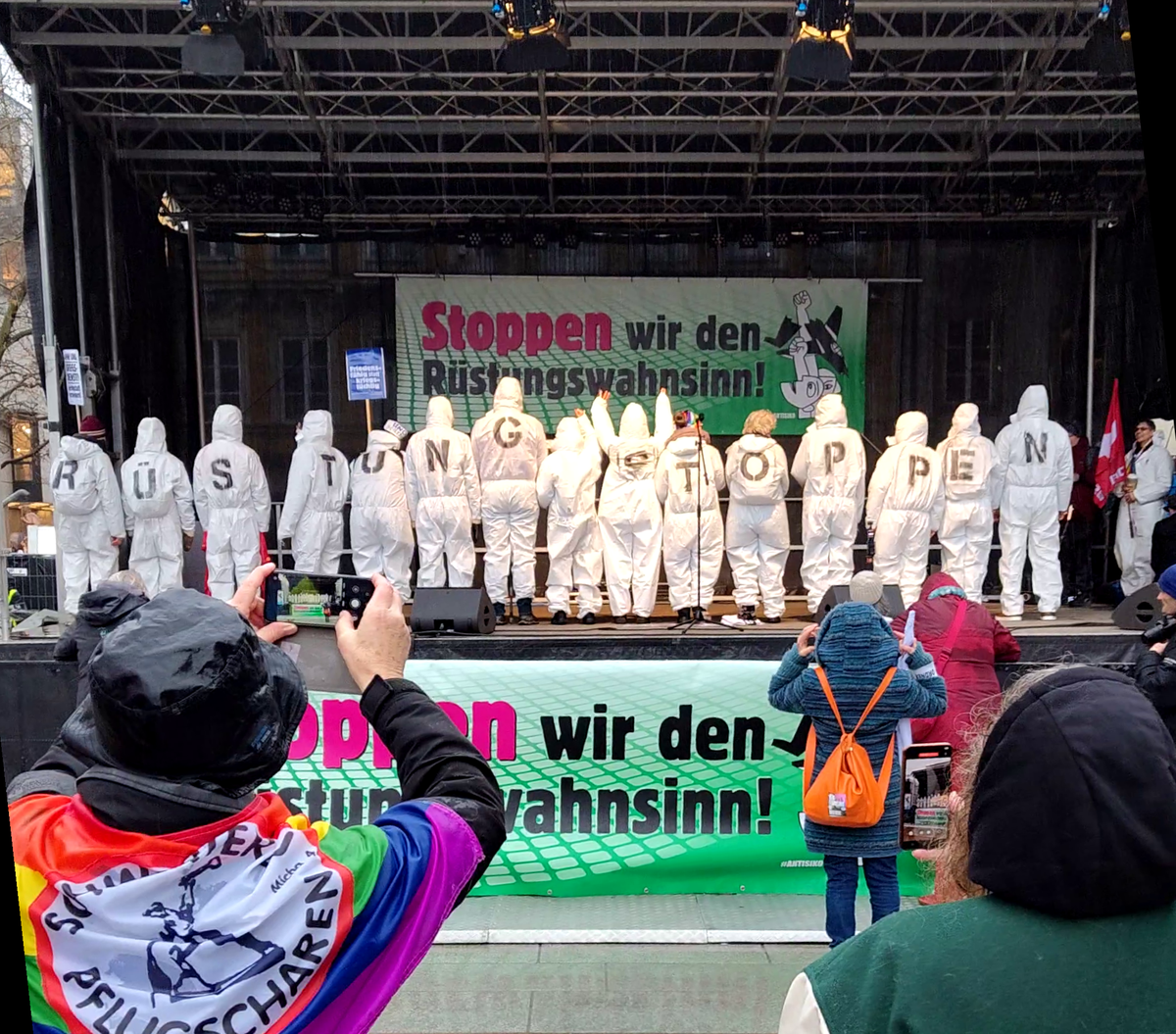


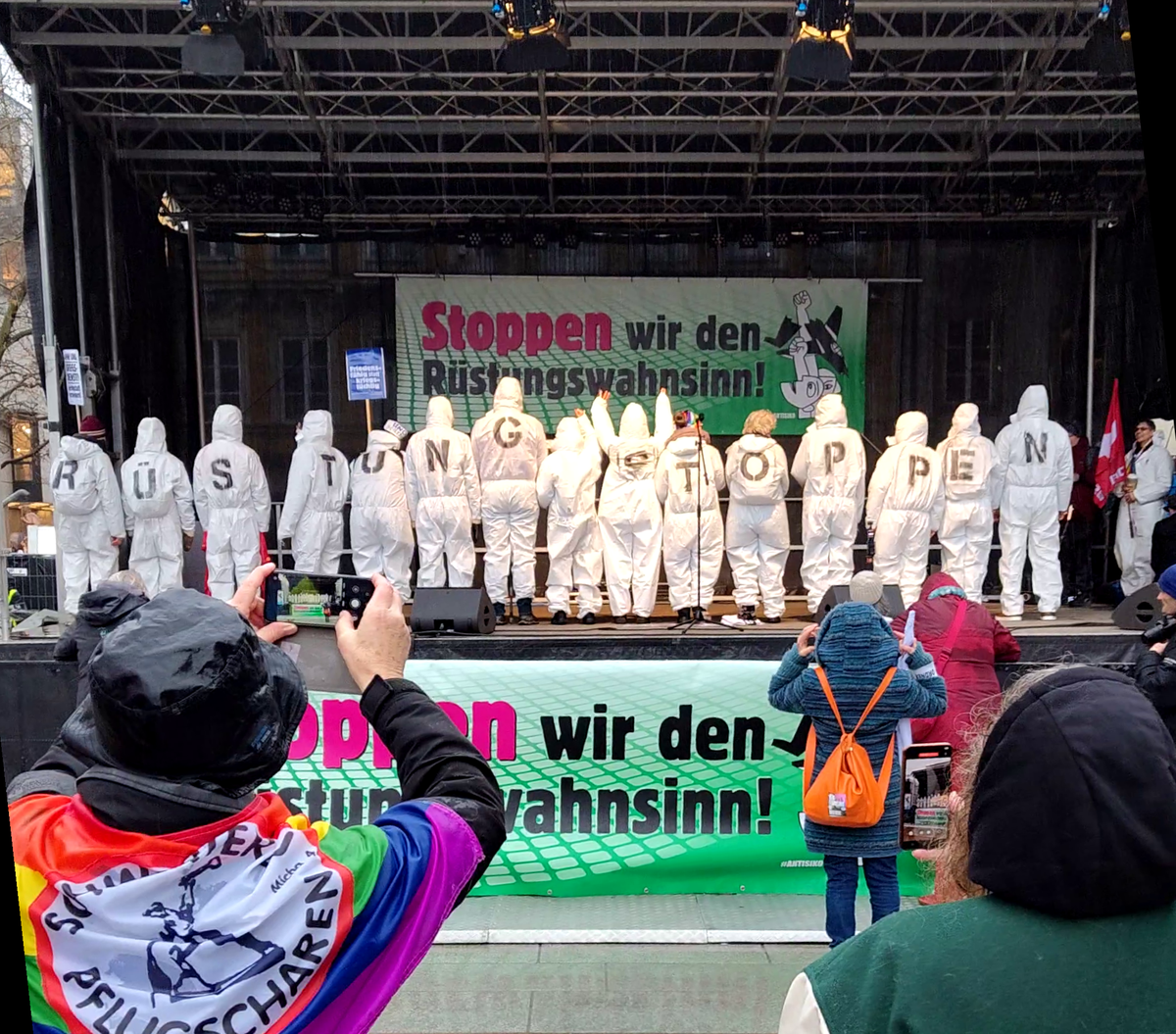



Wir befinden uns derzeit in unserer jährlichen Crowdfunding-Kampagne. Wenn Sie möchten, dass unser unabhängiges und gemeinnütziges Mediennetzwerk auch im Jahr 2025 fortbesteht, beteiligen Sie sich bitte an dieser Kampagne, indem Sie hier klicken. In diesem Video, das exklusiv auf Deutsch auf unserem Kanal veröffentlicht wurde, untersucht der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Journalist Glenn Greenwald, wie der […]
Der Beitrag Leak deckt auf: Tiefer Staat sabotiert Ukraine-Frieden erschien zuerst auf acTVism.
Wir befinden uns derzeit in unserer jährlichen Crowdfunding-Kampagne. Wenn Sie möchten, dass unser unabhängiges und gemeinnütziges Mediennetzwerk auch im Jahr 2025 fortbesteht, beteiligen Sie sich bitte an dieser Kampagne, indem Sie hier klicken. In diesem Bericht dokumentieren wir den Generalstreik vom 28. November 2025 in Genua, Italien – Teil einer landesweiten Mobilisierung gegen das Kriegsbudget, die […]
Der Beitrag Varoufakis, Thunberg & Albanese: Medien ignorieren Gaza-Demo weitgehend erschien zuerst auf acTVism.
Wir befinden uns derzeit in unserer jährlichen Crowdfunding-Kampagne. Wenn Sie möchten, dass unser unabhängiges und gemeinnütziges Mediennetzwerk auch im Jahr 2025 fortbesteht, beteiligen Sie sich bitte an dieser Kampagne, indem Sie hier klicken. In dieser Folge von Die Quelle spricht unser Chefredakteur Zain Raza mit dem internationalen Juristen Dimitri Lascaris über wichtige geopolitische Entwicklungen und analysiert […]
Der Beitrag Ukraine-Friedensdeal & Israels Völkermord: Was die Medien verschweigen erschien zuerst auf acTVism.
Heute starten wir unsere jährliche Crowdfunding-Kampagne mit dem Ziel, unseren unabhängigen und gemeinnützigen Journalismus auch im Jahr 2026 fortzusetzen – Journalismus, der frei von jeglicher äußeren Einflussnahme ist und kein Geld von Konzernen oder Regierungen annimmt. Die letzten zwei Jahre waren für unseren Kanal von besonderer Bedeutung. Wir konnten unsere Kapazitäten deutlich ausbauen, unser journalistisches […]
Der Beitrag Steht acTVism Munich vor dem Ende? Crowdfunding 2026 erschien zuerst auf acTVism.
Nach den Klimakonferenzen der letzten beiden Jahre in den Ölstaaten Aserbaidschan (Baku 2024, COP 29) und in den Vereinigten Arabischen Emiraten (Dubai 2023, COP 28) (1) und davor in Ägypten (Sharm El-Sheikh 2022, COP 27) (2) bin ich schon froh, dass die Weltklimakonferenz COP 30 diesmal zumindest in einem Land wie Brasilien stattfand, dessen Präsident, Luiz Inácio Lula da Silva, immerhin mehr Ambitionen hatte, ein vernünftiges Ergebnis für die weltweite Klimapolitik zu erzielen als absurderweise Ölscheichs, deren obszöner Reichtum genau darauf gründet, dass fossile Rohstoffe gefördert und weltweit verkauft und verfeuert werden.
Lula da Silva hat gleich zu Beginn der Konferenz davon gesprochen, dass dies eine „Konferenz der Wahrheit“ werde. Leider müssen wir nun, am Ende der Konferenz feststellen, dass die Wahrheit der internationalen Klimapolitik darin besteht, dass trotz der höheren Dringlichkeit durch weitere in 2024 gestiegene Treibhausgas-Emissionen noch nicht einmal eine minimale Einigung in wesentlichen Punkten einer internationalen Klimapolitik gegen den drohenden Klimawandel erreicht wurde.
Keine „Road-Map“ zur Konkretisierung des Ausstiegs aus Kohle, Öl und GasObwohl Lula da Silva schon zu Beginn der Konferenz seine ganze persönliche Autorität in die Waagschale gelegt hatte und eine solche Roadmap vorgeschlagen und darum geworben hatte, dass es einer solchen Konkretisierung und Bekräftigung des Ausstiegs aus Kohle, Öl und Gas bedürfe und obwohl 14 Tage lang darum gerungen und diskutiert wurde, gab es am Ende noch nicht einmal eine verbale Erwähnung der Worte Kohle, Öl und Gas als Hauptverantwortliche des vom Menschen verursachten Treibhauseffektes in der Atmosphäre und damit der bedrohlich sich permanent verschlimmernden globalen Klimaerwärmung.
Etliche Staaten engagierten sich nicht genug dafür und andere Staaten, vor allem die Golfstaaten, an erster Stelle Saudi-Arabien, kämpften mit ganzer Kraft dagegen. Immerhin gehörte Deutschland zu den Staaten, die sich für Lulas Plan einsetzten. Auch Umweltminister Carsten Schneider (SPD) war lt. SZ enttäuscht. Er stellte fest: „Wir waren konfrontiert mit einer sehr stark auftretenden Petroindustrie“. (3) Dass sich jedoch auch schon Mitglieder der Ampel-Regierung vor Ölscheichs verbeugt haben (s. Robert Habeck am 21.3.2021 vor Katars Handelsminister Scheich Mohammed bin Hamad Al Thani) (4) zeigt die Widersprüchlichkeit auch von grüner Partei und SPD in heutigen Zeiten.
Die fossile Industrie war nicht nur anwesend, sondern überproportional präsent, bestens organisiert und gezielt darauf vorbereitet, klare Formulierungen zu verhindern, die langfristig ihre Geschäftsmodelle infrage stellen könnten. Gleichzeitig waren viele Delegationen aus besonders bedrohten Regionen – Inselstaaten, afrikanischen Ländern, Teilen Asiens – finanziell und logistisch deutlich schwächer aufgestellt.
Der Klimagipfel in Belém war also kein Schritt in Richtung fossilfreie Zukunft, sondern ein deutliches Zeichen dafür, wie hart die Auseinandersetzung um die Klimazukunft geworden ist. Die fossile Lobby hat diesen Gipfel mitbestimmt – aber das darf sich nicht in die Zukunft fortsetzen.
Auch die bei vielen COPs schon aufgeworfenen Finanzierungsfragen wurden lange diskutiert, aber fast nichts wurde sinnvoll entschieden.Die schon 2009 in Kopenhagen von den reichen Industrieländern versprochenen 100 Mrd. Dollar/Jahr ab 2020 für einen Klimafonds zur Bekämpfung des Klimawandels auch im globalen Süden sind bis heute bei weitem nicht eingelöst. So ist das Vertrauen zwischen dem globalen Süden in Versprechungen des globalen Nordens schon seit längerem gründlich verspielt.
Bei der COP29 in Baku im Jahr 2024 wurden wieder einmal Versprechungen von den reichen Ländern gemacht: Bis 2035 kündigten sie an, die Hilfen auf 300 Mrd Dollar/Jahr anwachsen zu lassen, allerdings auch wieder nicht nur öffentliche Mittel als Zuschüsse, sondern überwiegend Kredite, insbesondere auch private.
In der Finanzdiskussion in Belem wurde vor allem auch das Thema Hilfsgelder für Anpassungsmaßnahmen angesprochen. Also Hilfen für ärmere Staaten um sich überhaupt etwas besser auf Überschwemmungen, Dürren, steigende Meeresspiegel oder Extremwetter-Katastrophen vorbereiten und evtl. daran anpassen zu können.
Die merkwürdige „Einigung“ sah so aus, dass sich die Mittel dafür verdreifachen sollen, es wurde aber nicht gesagt in welchem Zeitraum und in Bezug auf welche Basissumme diese Aussage gilt. Außerdem sollen die Gelder aus dem selben Finanzrahmen kommen, der in Baku für Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels versprochen wurde. Das Geld wurde also nicht aufgestockt, sondern nur anders verteilt, d.h. wenn mehr Geld in Anpassungsmaßnahmen fließen soll, dann gibt es weniger für den Umstieg auf klimafreundliche Technologien. Dies sind keine vernünftigen Beschlüsse, sondern lediglich ein Verschieben von einem Unterthema zu einem anderen.
Notwendigkeit einer grundsätzlich neuen Methodik bei zukünftigen internationalen KlimaverhandlungenAus dem eben gesagten folgt, dass es inzwischen unabdingbar notwendig ist, zu einer grundsätzlich neuen Methodik bei zukünftigen internationalen Klimaverhandlungen zu kommen, um die Klimakrise noch zu bewältigen.
Die ergebnisnegierenden und oft relativ unverbindlichen Diskussionen bei den bisherigen COPs müssen beendet werden und durch mehr verbindliche Beschlüsse in Richtung Bekämpfung des Klimawandels und Verbesserung der Adaptation ersetzt werden, am Ende auch mit Strafbewehrung bei Nichteinhalten der Beschlüsse. Die z.T. sogar direkt kontraproduktiven Diskussionen von eindeutig fossilistischen Lobbyisten müssen verboten werden.
Eine derartige Forderung wurde im isw schon vor vier Jahren, nach der Klimakonferenz COP26 von Glasgow erhoben. (5) Inzwischen hat sich aber die Situation des Klimawandels derart weiter verschlimmert, andererseits haben ausgesprochene Leugner bzw. Skeptiker des menschengemachten Klimawandels ganze Regierungen von großen Staaten übernommen, so dass die fossilistische Ideologie auf großer Front auf dem Vormarsch ist und ein regelrechtes „Roll Back“ veranstalten kann.
Die oft allgemeinen und unverbindlichen Diskussionen müssen ersetzt werden durch konkrete Vereinbarungen auf der Grundlage von transparenten Berechnungen für Finanztransfers von Staaten, die ihr zustehendes CO2-Budget schon seit Jahren überzogen haben.
Um solche Berechnungen gerecht durchzuführen, liegen alle Fakten transparent auf dem Tisch:
Ab diesem leicht zu ermittelnden Zeitpunkt emittiert jeder dieser Staaten jede Tonne CO2 komplett auf Kosten all der großen Mehrzahl der anderen Staaten, die ihr CO2-Budget noch nicht ausgeschöpft haben. D.h. solche Staaten sollten als Klimaschuldner geführt werden. Ihre Klimaschulden in Gigatonnen (Gt) CO2 sind mit einem gemeinsam zu vereinbarenden internationalen CO2-Ausgleichspreis sofort direkt umrechenbar in Klimaschulden in Dollar.
Bis heute werden bei den Klima-Konferenzen solche verbindlichen Berechnungen durch die reichen kapitalistischen Industrie-Länder und durch die Ölstaaten schon im Ansatz abgeblockt und komplett verhindert.
Leider verhalten sich auch die ärmeren Staaten des globalen Südens viel zu oft zu ängstlich, zu ruhig und unorganisiert, um solche Diskussionen und faktenbasierte Finanzberechnungsmethoden auf die Tagesordnung zu setzen und um überhaupt eine andere Art bzw. Methode der Konferenzen mit mehr Verbindlichkeit und Mehrheitsentscheidungen durchzusetzen.
Es wäre also nötig, diese Fakten gemäß der Wissenschaft anzuerkennen. Es sollte aber dann nicht nur bei wortreichen blumigen Erklärungen bleiben, indem z.B. die Überziehungsländer großmütig zugeben, in der Vergangenheit gesündigt zu haben, nun aber Verantwortung durch freiwillige milde finanzielle Gaben bei evtl. Klimakatastrophen und Hilfsaktionen übernehmen wollen und ihre Finanzmärkte mit den internationalen Finanzinstituten und Versicherungen ermuntern wollen, nun in „grüne“ Geschäfte einzusteigen.
Übrigens war die Zahl der Lobbyisten der globalen fossilen und Finanz-Industrie wieder die stärkste Gruppe auf der COP30, stärker als die größte Regierungsdelegation (außer Brasilien selbst).
Es sollte also eine Methode vereinbart werden, wie sich aus diesen Klimafakten transparent nachvollziehbare Berechnungen von Klimaschulden ergeben. Nach der Vereinbarung eines internationalen -Ausgleichspreises (z.B. 60 Dollar pro t CO2) sollten solche transparent nachvollziehbaren Reparationszahlungen wie sonstige Schulden völkerrechtlich verbindlich geregelt werden. D.h. die Zahlungen wären dann in Zukunft keine kleine, freiwillige milde Gabe, sondern eine aus der vergangenen und immer noch laufenden Überziehung des CO2-Budgets resultierende verbindliche Klima-Schuld-Verpflichtung. (6)
Für diese Zahlungen wäre ein UN-Klimafonds zu schaffen, der in demokratischer, völkerrechtlich korrekter und transparenter Weise über die Verteilung der Finanzen an arme Länder des globalen Südens für konkrete Transformations-, Anpassungs- und Reparatur-Projekte (Loss and Damage) wacht.
Die bis 2020 berechneten Daten sehen folgendermaßen aus:
Ein anderer Kritikpunkt an der Methode der Klimaverhandlungen ist das Prinzip der Freiwilligkeit und Unverbindlichkeit. Angesichts der Klima-Notstandsituation auf der Erde sollte es nicht mehr zulässig sein, dass nach dem Einstimmigkeitsprinzip ein Staat einen vernünftigen Mehrheitsbeschluss blockieren kann. Inzwischen sollte es darum gehen, dass effektive Klima-Maßnahmen mit Mehrheit global durchgesetzt und nicht durch einige wenige Staaten (z.B. die Ölstaaten) blockiert werden können.
Die COP30 ist ein Spiegel der globalen Kräfteverhältnisse: Die Welt steuert auf eine sehr gefährliche Erwärmung zu – und gleichzeitig schafft es die sog. “Staatengemeinschaft“ nicht, die Industrie zur Verantwortung zu ziehen, die historisch und aktuell am stärksten zur Krise beiträgt.
Das Ergebnis in Belém zeigt, wie dringend sofort neue Governance-Strukturen, klare Regeln für Lobby-Transparenz/-Beschränkung und stärkere Stimmen der Zivilgesellschaft sind. Am Ende ist wohl nur nach der Überwindung des globalen kapitalistischen Systems eine wirkliche Lösung des Klimaproblems und generell der Umweltkrise zu erreichen.
Regenwaldfonds, Tropical Forests Forever Facility (TFFF), wurde von Präsident Lula vorgeschlagen und gefördert.Die Tropical Forests Forever Facility (TFFF) soll den Schutz von Wäldern in ein dauerhaftes “Geschäftsmodell“ überführen: Länder, die ihre Wälder erhalten, sollen dafür bezahlt werden. Länder, deren Wälder verschwinden, sollen in den Fonds Strafe zahlen.
Für diesen Fonds sollen lt. Brasiliens Wunsch am Ende rund 125 Milliarden Dollar Gesamtkapital zusammenkommen – aus öffentlichen wie privaten Geldern, die am Finanzmarkt angelegt werden. Der Fonds soll mit 25 Milliarden Dollar starten. Einige Länder, u.a. Brasilien, Indonesien und Norwegen, auch Deutschland, haben bislang fast sieben Milliarden Euro für den Fonds zugesagt. Dieses Geld dient als Sicherheit. Es soll mögliche Verluste abfangen und Vertrauen schaffen. Auf dieser Grundlage will Brasilien weitere 100 Milliarden Dollar von privaten Investoren gewinnen, zum Beispiel von Pensionsfonds, Banken oder großen Unternehmen. Auch Strafzahlungen von Staaten sollen in den Fonds einfließen, Zahlungen sollen daraus finanziert werden; zur Kontrolle sollen Satellitenbilder eingesetzt werden.
Die Weltbank soll als Treuhänderin fungieren und das vorläufige Sekretariat des Fonds beherbergen. Für viele tropische Länder wäre der Fonds eine neue Einnahmequelle. Gerade die sehr waldreichen Länder Brasilien, Indonesien und die Demokratische Republik Kongo könnten zumindest theoretisch jeweils Hunderte Millionen Dollar jährlich aus dem Fonds erhalten, wenn sie die Waldzerstörung vollständig stoppen.
Teilnahmeberechtigt sollen 74 Länder in Afrika, Asien und Südamerika sein, die gemeinsam über eine Milliarde Hektar tropischer und subtropischer Wälder umfassen. Nur Länder mit einer Entwaldungsrate von unter 0,5 Prozent sollen profitieren. Außerdem müssen sie 20 Prozent der Mittel an indigene und traditionelle Gemeinschaften weitergeben – jene Gruppen, die nachweislich den geringsten Anteil an der Abholzung haben.
Ein zentrales Versprechen des TFFF lautet: Geld für den Waldschutz darf nicht am Ende doch in fossile Projekte fließen. Doch genau das muss der Fonds erst noch absichern. Zwar soll es eine sogenannte „Exclusion List“ geben – eine Liste von Branchen und Firmen, in die nicht investiert werden darf, etwa Kohle, Öl, Gas oder Unternehmen, die direkt zur Abholzung beitragen. Aber bislang existierten nur Grundsätze, keine detaillierten Ausschlussregeln.
Kritische Aspekte kommen z.B. von der Global Forest Coalition (GFC), einem internationalen Bündnis von Umweltorganisationen, indigenen Gruppen und Basisinitiativen: Wälder könnten zu “Finanzprodukten“ gemacht werden, die nach Rendite statt nach ökologischen Zielen bewertet werden. Der Fonds biete außerdem indigenen Völkern und lokalen Gemeinschaften nur eine symbolische Rolle, während Regierungen und Finanzinstitutionen die Kontrolle behalten würden. Die GFC fordert stattdessen direkte Finanzhilfen für indigene Gemeinschaften, verbindliche Schutzmechanismen und ein Ende der „Finanzialisierung der Natur“. Positive Stimmen betonen die Chance, dass durch den Fonds die Abholzung ernsthaft beenden werden kann.
Weitere Bemerkugen zur Klimakonferenz:Einen konkreten allgemeinen «Waldaktionsplan», um die Zerstörung von Wald einzudämmen, beschloss die Konferenz nicht. Es wurde lediglich an einen früheren Beschluss erinnert, die Entwaldung bis 2030 zu stoppen.
Immerhin wurde im Rahmen der regionalen „Kongobecken-Waldpartnerschaft“ der "Belém Call to Action for the Congo Basin Forests" verabschiedet. Darin verpflichten sich die Länder des Kongowaldbeckens, gemeinsam mit internationalen Partnern (auch Deutschland) bis 2030 eine Umkehr der Entwaldungstrends ihrer Region sicherzustellen.
Korea, der Staat mit dem siebtgrößten Kohlekraftwerkspark der Welt, ist auf der COP30 der Powering Past Coal Alliance (PPCA) beigetreten und hat verkündet, zwei Drittel der bestehenden Kohlekraftwerke bis 2040 stillzulegen und für die übrigen im kommenden Jahr einen Ausstiegsfahrplan festzulegen.
Weltweit nimmt die Bepreisung von klimaschädlichem CO2 zu. So gibt es inzwischen mindestens 38 Länder mit Emissionshandelssystemen, weitere 20 Länder bereiten deren Einführung vor. Brasilien kündigte die Gründung einer "Open Coalition for Compliance Carbon Markets" an und unterstreicht damit die Rolle von CO2-Bepreisung als ein Instrument für die globale Dekarbonisierung.
China ist für ca. 30% der globalen fossilen CO2-Emissionen verantwortlich, liegt jedoch beim Pro-Kopf-Verbrauch an fossilen CO2-Emissionen etwa gleichauf mit Japan bei ca. 8 t CO2/Jahr pro Kopf und bei ca. 58% des Wertes der USA, aber über dem Wert der EU. Die absoluten CO2-Emissionen stagnieren immerhin seit 18 Monaten oder fallen. 2025 könnte das erste Jahr sein, in dem die CO2-Emissionen zurückgehen, trotz Wirtschaftswachstum und steigender Stromnachfrage. Der Präsident der COP30, André Corrêa do Lago lobte China für seine Fortschritte im Bereich grüner Technologien: "China entwickelt Lösungen, die für alle gelten, nicht nur für China". Chinas Investitionen in Solar- und Windkraft treiben die Energiewende weltweit an.
Ein genereller Kritikpunkt – wie bei jeder COP-Klimakonferenz bisher: Das Militär wurde wie immer aus der Konferenz ausgeklammert.Immerhin hat Präsident Lula das Thema Militarisierung bei der Eröffnung angesprochen: "Wenn wir doppelt so viel für Waffen ausgeben wie für Klimaschutzmaßnahmen, ebnen wir den Weg für die Klimaapokalypse." Aber in der Konferenz wurde das Thema wie immer nicht behandelt. Dabei stehen sich natürlich Rüstung und Klimaschutz im doppelten Sinn diametral gegenüber:
Anders als bei vorherigen COP-Konferenzen in autoritären Staaten wie Aserbaidschan, Vereinigte Arabische Emirate oder Ägypten regte sich draußen im Zentrum der Millionenstadt Belem viel Protest. Ein Höhepunkt war ein mehrtägiger « Peoples Summit » mit 24.000 Teilnehmern aus über 800 zivilgesellschaftlichen und indigenen Organisationen hauptsächlich aus Brasilien und Lateinamerika auf dem Gelände der UFPA-Uni. (7) Es wurde eine Abschlusserklärung (8) verabschiedet, in der eine viel konsequentere Klimapolitik, Landrechte, historische Reparationszahlungen und eine größere Beteiligung der Zivilgesellschaft und indigener Gruppen bei der offiziellen COP gefordert wurden. Neben dem Kampf für eine gerechte Transformation wurde auch der Kampf gegen rechte Gruppierungen verankert, die sich als Leugner des anthropogenen Klimawandels und Gegner der Demokratie gezeigt haben.
Ein weiterer Höhepunkt war zur Halbzeit der Konferenz ein riesiger, bunter “Marsch fürs Klima“ von Siebzigtausend für mehr effektiven Klimaschutz. Unterschiedliche Karavanen der brasilianischen Bewegungen kamen zu Wasser und auf dem Landweg nach Belém. Indigene und andere Aktivisten belagerten im Kampf um mehr Mitsprache und Landrechte mehrfach das Gelände der Konferenz, einmal stürmten sie sogar die Eingangshalle der eigentlich stark gesicherten COP-Zeltstadt.
Zentrale Themen beim Summit waren die internationale Solidarität gegen Ungleichheit und Umweltrassismus sowie der Kampf gegen Straffreiheit von Unternehmen und falsche Klimalösungen, die eher Lebensgrundlagen zerstören, statt sie zu erhalten. Das Recht auf Nahrung, die Ernährungssouveränität und die aktive Einbeziehung der Betroffenen in die Lösungsfindung sollten zentrale Hebel für wirksamen Klimaschutz und die globalen Nachhaltigkeitsziele sein.
Ein ungezügelter Kapitalismus und die Kommerzialisierung der Natur stehen einer wirksamen Lösung der Klimakrise unversöhnlich gegenüber.
-------------------------
Quellen:
(1) H. Selinger, 1-2024: Absurdistan: Die Weltklimakonferenz COP28 in der Ölhauptstadt Dubai unter der Leitung eines Öl-Managers. Ein ergänzender Kommentar: https://www.isw-muenchen.de/online-publikationen/texte-artikel/5188-absurdistan-die-weltklimakonferenz-cop28-in-der-oelhauptstadt-dubai-unter-der-leitung-eines-oel-managers-ein-ergaenzender-kommentar?highlight=WyJzZWxpbmdlciJd
(2) H. Selinger, 12-2022: Klimagipfel COP27 in Sharm El-Sheikh: internationale Klimapolitik braucht prinzipielle Neuausrichtung: https://www.isw-muenchen.de/online-publikationen/texte-artikel/4970-69klimagipfel-cop27-in-sharm-el-sheikh-internationale-klimapolitik-braucht-prinzipielle-neuausrichtung?highlight=WyJzZWxpbmdlciJd
(3) Süddeutsche Zeitung (SZ) v. 24.11.2025, S. 7
(4) Handelsblatt v. 21.3.2022
(5) H. Selinger 11-2021 „Verlauf von Glasgow-Konferenz zeigt: Völlig andere Art Klimakonferenz nötig für Bewältigung der Klimakrise“: https://www.isw-muenchen.de/online-publikationen/texte-artikel/4304-3verlauf-von-glasgow-konferenz-zeigt-voellig-andere-art-klimakonferenz-noetig-fuer-bewaeltigung-der-klimakrise
(6) H.Selinger 2015 Transform! Europe Paying climate debts for global climate justice: https://transform-network.net/blog/article/paying-climate-debts-for-global-climate-justice
Die Beschäftigungssituation im deutschen verarbeitenden Gewerbe hat sich im Jahr 2025 deutlich verschärft. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes, Destatis ist vor allem die Automobilindustrie von einem überdurchschnittlichen Beschäftigungsabbau betroffen.
Zum Ende des dritten Quartals 2025 waren in dieser Branche rund 48.700 Personen weniger beschäftigt als im Vorjahreszeitraum, was einem Rückgang von 6,3 Prozent entspricht. Damit verzeichnet die Branche den stärksten prozentualen Beschäftigtenrückgang innerhalb der großen industriellen Sektoren Deutschlands. Mit insgesamt 721.400 Beschäftigten erreicht die Branche den niedrigsten Stand seit dem zweiten Quartal 2011.
Nach dem Maschinenbau bleibt die Automobilindustrie trotz des Rückgangs weiterhin der zweitgrößte Industriezweig Deutschlands. Der Stellenabbau in der Automobilbranche verweist auf tiefgreifende Transformationsprozesse innerhalb der existierenden kapitalistischen Produktionsverhältnisse.
2. Differenzierte Betroffenheit innerhalb der AutomobilbrancheInnerhalb der Automobilindustrie zeigen sich erhebliche Unterschiede zwischen Herstellern und Zulieferbetrieben. Nach Branchendaten des Statistischen Bundesamts verringerte sich die Beschäftigtenzahl im Bereich der Herstellung von Kraftwagen und -motoren um 3,8 Prozent auf 446.800 Personen. In den Zulieferbereichen fällt der Rückgang jedoch deutlich stärker aus: Die Produktion von Karosserien, Aufbauten und Anhängern verzeichnet ein Minus von 4,0 Prozent, während im größten Zuliefersegment – der Herstellung von Teilen und Zubehör – der Beschäftigungsrückgang 11,1 Prozent erreichte. Dies entspricht einer Verringerung auf etwa 235.400 Beschäftigte.
Der höhere Beschäftigungsabbau bei Zulieferern ist auf verschiedene Faktoren zurückführen: Zum einen erfolgt die Elektrifizierung der Antriebssysteme mit einer deutlichen Reduktion mechanischer Komponenten, wodurch der Bedarf an traditionellen Teilen (z. B. Verbrennungsmotoren, Getrieben, Abgassystemen) sinkt. Zum anderen stehen viele mittelständische Zulieferunternehmen vor der Herausforderung, ihre Produktportfolios und Produktionsprozesse an neue technologische Anforderungen anzupassen, wofür oft Kapital- und Innovationsressourcen fehlen bzw. aus Gründen der wirtschaftlichen Unsicherheit Investitionen ausbleiben.
3. Ursachen für den BeschäftigungsrückgangDie Ursachen für die Beschäftigungsverluste in der deutschen Industrie lassen zunächst in einen makroökonomischen, technologischen und standortpolitischen Kontext einordnen:
Technologischer Strukturwandel: Der Übergang von Verbrennungsmotor zu elektrischen und hybriden Antrieben führt zu einer erheblichen Verringerung des Arbeitskräftebedarfs in der Fahrzeugproduktion. Elektrofahrzeuge benötigen weniger Komponenten und erfordern andere Fertigungstechnologien, wodurch bestimmte Qualifikationen obsolet werden. Zum Vergleich: ein Dieselaggregat besteht aus ca.1.400 Teilen, währen ein E-Motor aus ca. 200 Teilen besteht.
Aber die grundsätzliche Ursache des Stellenabbaus ist, dass unter kapitalistischen Produktionsverhältnissen die Kapitalanhäufung durch die Einführung von technologischem Fortschritt vorangetrieben wird, was prinzipiell zu einer Reduktion der notwendigen Arbeitskräfte führt. Der technologische Wandel in der Automobilindustrie, der durch den Übergang zur Elektromobilität und Digitalisierung geprägt ist, entspricht diesem Prinzip. Die verstärkte Automatisierung und Automatisierungstechnologien führen dazu, dass weniger Arbeiter für die gleiche Produktion benötigt werden, was zwangsläufig zu einem Stellenabbau führt. Der Stellenabbau ist somit als ein Ergebnis der Widersprüche im kapitalistischen Produktionsprozess zu werten. Die systemimmanente und zwangsläufig gewollte Steigerung der Profitabilität und Automatisierung kapitalistischer Unternehmen führen zu einer Überakkumulation an Kapital und zu Überproduktion. Dies erzeugt eine Krise, die sich in Massenarbeitslosigkeit manifestiert, da die Arbeitskraft als Produktionsfaktor immer weiter entwertet wird. Der Stellenabbau ist also kein Zufall, sondern ein notwendiges Ergebnis der systeminternen Dynamiken.
Hinzu kommt, dass die zunehmende Konkurrenz durch chinesische Hersteller, die kostengünstig und technologisch innovativ im Segment der Elektromobilität auftreten, hat die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Produzenten empfindlich geschwächt. In den letzten Jahren konnten chinesische Anbieter ihren Marktanteil in Europa signifikant steigern, was insbesondere die Nachfrage nach deutschen Fahrzeugen reduziert hat.
Handelskonflikte, fragile Lieferketten und eine gesunkene Konsumnachfrage in Europa im Zuge der wirtschaftlichen Abkühlung bis hin zur gegebenen Rezession in Deutschland 2024/25 beeinflussen die Industrieproduktion negativ. Gleichzeitig belasten die durch politisches Fehlverhalten gestiegene Energiepreise die Kostenstruktur energieintensiver Industrien in Deutschland, was die führenden Automobil-Unternehmen aus deren Kapital-Sicht zu Einsparungen zwingt.
Vergleich mit anderen IndustriebranchenIm Vergleich zu anderen Industriezweigen ist die Automobilindustrie aufgrund ihrer hohen Verflechtung mit nachgelagerten Branchen von besonderer gesamtwirtschaftlicher Relevanz. Jeder Arbeitsplatz in der Automobilindustrie ist direkt oder indirekt mit etwa sieben weiteren verbunden. Entsprechend zieht der Abbau in diesem Sektor Arbeitsplatzverluste und Strukturanpassungen in angegliederten Bereichen nach sich.
Auch in anderen industriellen Teilsektoren zeigen sich rückläufige Beschäftigungsentwicklungen, allerdings nicht in gleichem Ausmaß. Der Maschinenbau, die chemische Industrie und die Elektrobranche verzeichneten bis zum dritten Quartal 2025 Beschäftigungsrückgänge zwischen 1,5 und 2,5 Prozent. Diese Sektoren sind insbesondere betroffen von dem Nachfragerückgang aus wichtigen Exportmärkten, etwa China und den USA. Besonders stark betroffen ist der Maschinen- und Anlagenbau, der stark exportorientiert ist und empfindlich auf protektionistische Maßnahmen reagiert.
Langfristig könnte eine Stabilisierung der industriellen Beschäftigung in Deutschland durch eine entschlossene Umsetzung der ökologischen und digitalen Transformation erreicht werden. Dazu zählen, beispielhaft erwähnt, eine Diversifizierung der Produktportfolios hin zu Elektromobilitätskomponenten, möglicherweise eine annähernd konkurrenzfähige Batterieproduktion und Softwareintegration; In jedem Fall wären Qualifikationsoffensiven zur Umschulung von Arbeitskräften in Bereichen wie Elektrotechnik, IT und nachhaltiger Produktion; Investitionen in Forschung und Entwicklung zur Stärkung der Innovationskraft kleiner und mittlerer Zulieferbetriebe von wirtschaftlichem Vorteil. Diese Maßnahmen können im Rahmen der existierenden kapitalistischen Produktionsverhältnisse einen Strukturwandel abfedern, ersetzen jedoch nicht die jetzt wegfallenden Arbeitsplätze.
FazitDer aktuelle Stellenabbau in der deutschen Industrie ist kein zufälliges oder rein technisches Phänomen, sondern eine systemimmanente Folge des Kapitalismus. Insbesondere ist der Stellenabbau in der Automobilindustrie Ausdruck struktureller Anpassungsprozesse, die mit der Digitalisierung, Dekarbonisierung und geopolitischen Umbrüchen einhergehen. Er ist Ausdruck der Tendenz zur Automatisierung, des Widerspruchs zwischen der Konzentration von Kapital und der Produktivitätssteigerung sowie der Krisenhaftigkeit des kapitalistischen Systems, die durch Überakkumulation und Überproduktion gekennzeichnet ist. Die deutsche Industrie befindet sich in einer Phase der Auswirkungen anhaltender Rezession. Während kurzfristig Beschäftigungsverluste unvermeidlich erscheinen, bietet eine gezielte Industriepolitik langfristig Chancen für eine nachhaltigere und innovationsorientierte Industriestruktur. Dazu gehörten grundsätzlicher Art, die Produktion an gesellschaftlichen Bedürfnissen (Wohnen, Gesundheit, Mobilität, ökologische Reproduktion) auszurichten. Zudem sind die zentraler Bereiche Energie, Verkehr, Grundstoffindustrie, digitale Infrastrukturen dem Markt zu entziehen und einer demokratischen Kontrolle durch gesellschaftliche Organisationen zuzuführen. Voraussetzung dafür wäre ein schlüssiges, an den arbeitenden Menschen ausgerichtetes politisch-ökonomisches Rahmenkonzept erforderlich, das Investitionen, Weiterbildung und technologische Entwicklung fördert.
-------------------------
Quellen
Bardt, H., & Lichtblau, K. (2023). Digitalisierung und industrielle Produktion in Deutschland. Institut der deutschen Wirtschaft (IW), Köln.
Bratzel, S. (2025). Elektromobilität und globale Konkurrenz: Neue Spielregeln in der Automobilindustrie. Center of Automotive Management, Bergisch Gladbach.
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) (2025). Transformation der Automobilindustrie: Jahresbericht 2025. Berlin.
https://www.isw-muenchen.de/online-publikationen/texte-artikel/5384-wirtschaftliche-stagnation-in-deutschland
https://www.isw-muenchen.de/online-publikationen/texte-artikel/5357-auto-hersteller-und-zulieferer-ruestungsgeschaeft-als-geschaeftserweiterung?highlight=WyJzdGVsbGVuYWJiYXUiXQ==
https://www.isw-muenchen.de/online-publikationen/texte-artikel/5380-vertrauenskrise-des-kapitalismus-in-deutschland-doch-wem-nuetzt-es
Destatis (2025a). Beschäftigte im Verarbeitenden Gewerbe, 3. Quartal 2025. Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.
Destatis (2025b). Produzierendes Gewerbe: Detaillierte Branchenergebnisse. Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.
ifo Institut (2024). Beschäftigungseffekte in der Automobilindustrie: Input-Output-Analyse. München.
OECD (2025). Economic Outlook 2025/2: Germany. Paris.
https://de.statista.com/infografik/35513/veraenderung-der-anzahl-der-beschaeftigten-in-ausgewaehlten-industriebranchen/?lid=wi9d2gvmlzzz
Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) (2025). Konjunkturbericht Maschinenbau, 3. Quartal 2025. Frankfurt am Main.
Vortrag in Bayreuth auf den 20. Bayreuther Gesprächen im Wilhelm-Leuschner-Zentrum am 30. September 2025 in Kooperation mit dem DGB-Oberfranken
„Wir lernen aus der Geschichte, dass wir nichts lernen.“
Mit dieser Erfahrung meiner Frau, die mehr als vierzig Jahre an zwei Gymnasien Geschichte unterrichtet hat, will ich nicht provozieren, sondern auf das grundsätzlich fragwürdige von historischen Vergleichen aufmerksam machen. Mit Recht betont der Historiker Martin Sabrow die Ambivalenz jedes historischen Vergleichs: „Er ist ein unentbehrliches Instrument der Geschichtsschreibung, tendiert aber dazu, die Vergangenheit aus der Perspektive der Gegenwart zu beleuchten und damit zu verengen. Seine Stärke liege in der selbstreflexiven Herausforderung, da die Wahl des Vergleichsfalls, mit dem ein Untersuchungsgegenstand in Beziehung gesetzt wird, immer eine ‚normative Vorentscheidung‘ bedeute.“ (1) Meine eigene „normative Vorentscheidung“ besteht darin, dass ich erstens Antifaschist bin und zweitens, dass ich Ähnlichkeiten zwischen 1933 und 2025 ahne, aber angestrengt darüber nachdenken muss, ob es mehr Ähnlichkeiten oder mehr Differenzen gibt. Sicher aber ist, dass die gegenwärtigen Bedingungen einerseits auf denen der Vergangenheit stehen, andererseits aber auch einem Wandel unterliegen. Gegenwärtig haben wir das Wissen, wie sich Anfang 1933 der deutsche Faschismus kontinuierlich entwickelte – dieses Wissen hatte die deutsche Bevölkerung vor 1933 nicht.
Um das Ergebnis meines Nachdenkens und meines Vortrags vorwegzunehmen: Ich glaube nicht, dass wir 2025 am gleichen Punkt stehen wie Anfang 1933 (2) und ich will das kurz begründen. Mein erstes Argument ist quantitativer Natur, denn viel zu viele Variablen machen die beiden Jahre unvergleichbar. Mein zweites Argument ist qualitativer Natur. Der Faschismus der NSDAP war nicht nur ultrarechts, sondern war eine rechtsterroristische Bewegung, die sich insbesondere gegen die sozialistische Arbeiterbewegung von KPD und SPD richtete. Selbst wenn man den rechtsextremen Gewaltterror der Wehrsportgruppe Hoffmann zwischen 1973 und 1982 (3), den des rechtsextremen NSU zwischen 2000 und 2007 mit zehn Toten, (4) die militärischen Gewaltphantasien der Reichsbürgerbewegung oder das riesige Kriegswaffenarsenals von Rechtsradikalen in Remscheid berücksichtigt, gibt es gegenwärtig keine der SA vergleichbare terroristische Bewegung. Gegenwärtig gibt es auch keine sozialistische Arbeiterbewegung, die einem historischen Faschismus notwendigerweise und definitorisch als Antipode diente. Und ein Vergleich des Parteiprogramms der NSDAP und Hitlers Kampfschrift „Mein Kampf“ mit dem Parteiprogramm der AFD zeigt, dass die AFD „nur“ rechtsextrem ist, mit ihrer Ausländerfeindlichkeit aber nicht die Qualität des extinktistischen Antisemitismus der Nazis erreicht.
Transformation der Demokratie und AmerikanisierungEine kritische Analyse des Vergleiches von 1933 mit 2025 übersieht allzu häufig erstens die damaligen und heutigen Kapitalkräfte und zweitens geopolitische Zusammenhänge. Für die Gegenwart kann man von einer unheilvollen Transformation der Demokratie (5) ausgehen. Was meint das? In einer transformierten Demokratie spiegelt das Parlament nicht länger den Volkswillen, sondern hat sich zu einem antidemokratischen Forum entwickelt, deren Parteien Teil des Staates geworden sind und die die Direktiven einer Wirtschaftsoligarchie in die Medien transformieren. Die 5.000 Lobbyisten in Berlin und die 20.000 Lobbyisten in Brüssel sind hierbei nur die kleine sichtbare Spitze eines Eisbergs. Immerhin beläuft sich der Aufwand der Berliner Lobbyindustrie auf rund 1 Mrd. Euro. Mit einem Parlament als Kulisse werden in dieser transformierten Demokratie die Gegensätze von Kapital und Arbeit nur scheinbar harmonisiert und nur äußerlich befriedet; bei weitgehend entpolitisierten Gewerkschaften resultiert diese Befriedung in deren traditioneller Strategie der Sozialpartnerschaft. Scheinbar von der Mehrheit der Bevölkerung getragen, stabilisiert sich in der transformierten Demokratie auf diese Weise die gesamte Herrschaftsordnung. In ihr kann der Gegensatz von Kapital und Arbeit nur noch im Bereich der Kulturarbeit thematisiert werden (z. B. bei Hochhuth, Böll, Schlingensief, Jelinek, Peymann), übernimmt aber als Symbolpolitik häufig nur Ventil- und Alibifunktion.
Mit anderen Worten: Alle demokratischen Parteien haben ihren Burgfrieden mit dem Kapital gemacht, haben es hingenommen, dass abhängig Beschäftigte verarmten, haben linke, sozialistische und antikapitalistische Kräfte zerstört und damit rechten Kräften zugetrieben. In der Weimarer Republik war das ein kurzer Prozess, der nur zehn Jahre dauerte und der sich in der BRD länger hinzog, aber prinzipiell war der politische Prozess derselbe. Dieser Prozess war in der BRD im Vergleich zu anderen westeuropäischen Ländern deswegen besonders ausgeprägt, weil die BRD ein „Frontstaat“ war. Die politischen Parteien – in Art. 21 GG Fmit einem besonderen Schutz und der Kraft ausgestattet, die „Willensbildung des Volkes“ mitzugestalten (nicht: zu gestalten) – haben sich inzwischen zu staatsnahen Kartellparteien transformiert. (6) Diese Staatsparteien mit ihrer parlamentarischen Fraktionsdisziplin, ihren Parteisoldaten und ihrer Funktionselite haben sich völlig vom Volkswillen (Art. 20 GG) entfernt. CDU-, SPD-, FDP- oder Grünenpolitiker, ob Friedrich Merz, Lars Klingbeil, Christian Lindner oder Omid Nouripour wurden zu austauschbaren und flexibel rotierenden Marionetten in einer nur mit sich selber kommunizierenden sozio-kulturellen Blase.
Diese Transformation ist gegenwärtig ein idealer Nährboden für die AfD.Der radikaldemokratische Wiederaufbauprozess der BRD nach 1945, auch mit einer CDU, die wie im Ahlener Programm, in ihrem starken christlichen Arbeitnehmerflügel, Ideen einer solidarischen Ökonomie des katholischen Theologen Oswald von Nell-Breuning und dem Konzept einer sozial abgefederten Marktwirtschaft eines Ludwig Erhard „linke“ Züge aufwies, dauerte nur kurze Zeit an. Nur kurz nach dem Hitler-Faschismus flossen erhebliche Finanzmittel der Firmen Krupp, Flick, Siemens, Oetker und der Deutschen Bank in die CDU, CSU und FDP, nachdem genau diese Unternehmen in der Weimarer Republik zunächst rechte Parteien wie das Zentrum oder die DNVP, und dann die NSDAP finanziert hatten. Nach 1945 unterstützten die westlichen Militärregierungen und die von ihnen lizensierten Medien wie Welt, Spiegel, SZ und Zeit genau diesen politischen Kurs, wobei gerade „Die Zeit“ ein Auffangbecken alter Nazi-Journalisten gewesen war.
Diese Politik in Deutschland ist zweitens geopolitisch einzuordnen. Eine Amerikanisierung der europäischen Politik gilt seit 1918 besonders für Deutschland. Sogar während der Nazi-Zeit waren die folgenden US-Konzerne in Deutschland aktiv: Ford, GM, Remington, DuPont, CocaCola, IBM, ITT, Texaco, United Fruit, John Deere oder Standard Oil. Der Marshallplan brachte den USA nach 1945 eine ungeheuerliche Ausdehnung ihres Kapitals in Deutschland. (7)
Diese Amerikanisierung von Kapital, Börsen, Investmentfonds, Technologie, Militär, Politik, Medien, der Consulting-Branche usw. hat in der BRD und im gesamten westlichen Europa die unheilvolle Transformation der Demokratie befördert. Für die BRD kann man die Jahre 1960 bis 1990 als eine Ausnahmephase ansehen, sozialdemokratisch wurde die Transformation abgepuffert und abgefedert und auf Gewerkschaftsseite gab es nicht nur eine herrschaftskonforme Strategie der Sozialpartnerschaft, sondern auch den Anspruch, Tarife nicht nur durchzusetzen, sondern auch allgemeinpolitisch abzusichern.
Das Ende dieser sozialdemokratischen Phase Anfang der neunziger Jahre fiel nicht zufällig mit weiteren Wechseln und Weichenstellungen zusammen. 1. In der Industrie löste der Postfordismus die veraltete Massenproduktion standardisierter Güter durch flexible Produktionsformen ab. 2. Bei der Zusammensetzung des Bruttoinlandsprodukts wurde der Dienstleistungssektor endgültig größer als der industrielle Sektor. 3. Parallel zur drastischen Abnahme der Staatsquote wurden Güter und Dienstleistungen der allgemeinen Daseinsvorsorge radikal dem privaten Kapital zugeführt. 4. Mit dem Ende der DDR gab es auch ein Ende der Systemkonkurrenz. 5. In Folge der französischen Philosophien von Michel Foucault und Jacques Derrida löste in der Gesellschaftswissenschaft ein sprach- und kulturkritisches Räsonieren die bislang vorherrschende Ideologiekritik und eine politökonomische Analyse ab. Systemkritik mutierte zu wechselnder politischer Kultur. Alle fünf Veränderungen gegenüber der sozialdemokratischen Phase von 1960 bis 1990 schlugen drastisch auf die gesamte Bevölkerung durch.
In einer einst kontroversen und konfliktiven Parteienlandschaft positioniert sich in Deutschland die Sozialdemokratie nicht länger als Arbeiterpartei, sondern als Partei der Mitte, die Gewerkschaften beanspruchen für sich immer weniger einen eigenen politischen Auftrag, handeln größtenteils nicht mehr autonom, sondern Arm in Arm mit der Sozialdemokratie und die politische Linke ist eine historisch zu vernachlässigende Rest- und Randgröße geworden, vergleicht man sie in der Weimarer Republik mit einer revolutionären KPD, die 1932 17% aller Stimmen auf sich vereinen konnte oder der reformistischen SPD mit 37,9% 1919 oder 29,8% 1928.
Geopolitisch vollziehen sich aber gegen die hier vielfach aufgeführten Beispiele einer Amerikanisierung der BRD völlig andere politische Prozesse. Der ungleich größere „Rest“ der Menschen – etwa 7 Mrd. Menschen im globalen Süden gegen 1 Mrd. Menschen im Westen – organisiert sich anders und gegen die USA, wenn auch keineswegs einheitlich. Unter Führung von China blüht, wächst und gedeiht ein immens starker und größer werdender Tiersmondismus. In der Ukrainepolitik unterstützen nur rund 40 von 193 UN-Mitgliedstaaten den US-geführten Minderheiten-Kapitalismus und in der Israelpolitik sind es noch bei weitem weniger Länder. In beiden Fällen befördert diese Politik eine weitere Isolierung des US-geleiteten Westens.
Schon aus reinem Eigeninteresse kann Deutschland seine außenpolitische Isolation nur dadurch aufbrechen, in dem es auf allen Ebenen und Gebieten eine Kooperation mit neuen Partnern jenseits der 40-Länder-Grenze sucht. Vor allem müssten die ökonomisch nur kurzfristig zu erzielenden Gewinne der gegenwärtigen Freihandelsverträge mit einzelnen Ländern der Dritten Welt so verändert werden, dass beide Vertragspartner auf Augenhöhe einen langfristigen Gewinn für sich erzielen könnten. Im Gegensatz zur jetzigen Ausbeutung des Südens müssten dann aber die komparativen Kostenvorteile für beide Seiten gleichmäßig und gerecht verteilt werden.
Gewerkschaften – damals und heuteKonstant scheint mir die Verantwortung der Gewerkschaften für die Demokratie zu sein und das aus wenigstens zwei Gründen. Auch wenn man trefflich darüber streiten kann, ob es heute noch Arbeiter gebe oder nicht, so produziert der Gegensatz von Kapital und Arbeit nach wie vor abhängig Beschäftigte. (8) Außerdem entziehen sich Gewerkschaften als autonome gesellschaftliche Gruppe den Gefahren in einem parlamentarischen Rahmen transformiert zu werden.
In der Nazizeit haben sich einerseits viele Gewerkschafter – wie in Solingen – freiwillig und von sich aus der faschistischen Deutschen Arbeitsfront (DAF) angeschlossen, waren andererseits aber auch aktiv im antifaschistischen Widerstand und wurden deshalb zu tausenden in Gefängnissen und KZs gefoltert, hingerichtet, getötet und ermordet.
Wilhelm Leuschner war einer der herausragenden sozialdemokratischen antifaschistischen Widerstandskämpfer, der als Mitglied nationalkonservativer Kreise nach dem Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 am 29. September 1944 von den Nazis ermordet wurde. Als bedeutender Sozialdemokrat war Leuschner 1928 Innenminister des Volksstaates Hessen (also Hessen-Darmstadt, Rheinhessen und Oberhessen). In einem möglichen Schattenkabinett von Generaloberst Ludwig Beck und dem Leipziger Oberbürgermeister Carl Goerdeler war Leuschner im Gespräch als Vizekanzler einer zukünftigen neuen deutschen Regierung. Als entschiedener Antifaschist wurde Leuschner im Januar 1933 Vorstandsmitglied im Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund (ADGB) und setzte sich dort für eine Einheitsgewerkschaft ein. Wegen seiner Weigerung, mit den Nazis und der DAF zu kooperieren, wurde Leuschner im Mai 1933 verhaftet und war unter den Nazis zwei Jahre in den Zuchthäusern und KZs Börgermoor/Niedersachsen, Rockenberg/Hessen und Lichtenburg in Prettin/Sachsen-Anhalt interniert.
Für seinen andauernden Kampf um eine Einheitsgewerkschaft sind die Memoiren des Kommunisten Wolfgang Langhoff aus dem KZ Börgermoor aufschlussreich. Der Mitautor des Textes des berühmten Liedes „Die Moorsoldaten“ sprach von dem Sozialdemokraten Leuschner in den höchsten Tönen. Es habe zwischen ihm und den kommunistischen Gefangenen „ein durchaus freundschaftlich-kameradschaftliches Verhältnis“ gegeben und Leuschner habe es mit seinem „kameradschaftlichen Verhalten“ verstanden, „mit allen Barackeninsassen im besten Einvernehmen zu sein“. Gleichermaßen positiv hatte er sich schon vor der Veröffentlichung seiner Erinnerungen geäußert, nämlich 1946 im „Neuen Deutschland“: Leuschner sei ein „patenter Kerl“ und „freundlicher Mann“ gewesen, ein kluger Freund der Arbeiterschaft“ und ein „guter Kamerad, der mich das Leben und die Menschen lieben lehrte.“ (9)
Hatten die sozialdemokratischen und kommunistischen Widerstandskämpfer während ihrer gemeinsamen Leidenszeit in den KZs ihre politischen Auseinandersetzungen aus der Weimarer Republik überwinden können, so forderten sie am 19. April 1945 im KZ Buchenwald gemeinsam eine „Volksfront aller antifaschistischen Kräfte“ und die „Bildung von antifaschistischen Einheitsgewerkschaften“. Während ihrer Zeit im KZ hatten sie erkannt, dass die Spaltung der Arbeiterschaft in Sozialdemokraten und Kommunisten der NSDAP zur Macht verholfen hatte. Dementsprechend heißt es noch heute in der Satzung der IG Metall, dass es in dieser Gewerkschaft keinen Platz für „neofaschistische, militaristische und reaktionäre Elemente“ geben könne. (10)
Eine gemeinsame Politik von SPD und KPD zur Verhinderung eines faschistischen Staates scheiterte an strukturellen Versäumnissen und Fehlern auf beiden Seiten. Nach Einschätzung des Marburger Politikwissenschaftlers Wolfgang Abendroth von 1976 hatte die KPD für eine Einheitsfront-Politik keinerlei strategisches Konzept und der SPD ging es vorrangig um eine Stabilisierung der alten Machtverhältnisse. (11) Auch heutige Historiker wie Mark Jones teilen diese Perspektive meines akademischen Lehrers Abendroth: „Für Ebert waren die deutschen Kommunisten die Todfeinde der SPD. Es gab Zeiten, in denen sie sein Leben bedrohten und Zeiten, in denen er seinerseits Soldaten befahl, mit härtester Gewalt gegen kommunistische Aufstände vorzugehen. Für Ebert hatte politische Stabilität oberste Priorität. Er empfand gegenüber der Republik ein Pflichtgefühl, das ihn zu einem vehementen Unterstützer der Großen Koalition Stresemanns machte. Er wünschte, dass die SPD-Kompromisse mit der DVP einging, statt Verbindungen zur KPD zu knüpfen.“ (12)
Auch der Antifaschist Wilhelm Leuschner hatte sich heftig von Kommunisten distanziert. Er ging davon aus, dass die Kommunisten die Weimarer Republik ebenso zerstört hätten wie die Nationalsozialisten und dass eine Sozialdemokratie gegen beide Kräfte gleichermaßen zu kämpfen habe. (13) Diese Einschätzung ist aber empirisch falsch – die militante Gewalt der SA war um ein Mehrfaches zerstörerischer als alle Militanz von kommunistischer Seite. Allein im Reichstagswahlkampf 1932 sorgte die SA mit ihren fast einer halben Millionen Mitgliedern für 300 Tote und mehr als 1.000 Verletzte. Doch hinter Leuschners Gleichsetzung von Kommunisten mit Nazis steht die nach wie vor beliebte Gleichsetzung von Links- mit Rechtsextremismus. Erst kürzlich verstieg sich der CDU-Politiker Roland Koch zu der Behauptung, dass Deutschland linker werden würde, wenn man die AfD wählen würde. (14) Doch diese sogenannte Hufeisentheorie ist – sorry! – aus historischer und sozialwissenschaftlicher Sicht nicht nur Ideologieproduktion, sondern einfach Quatsch.
Selbstverständlich gab es in der Arbeiterbewegung Berührungspunkte zwischen kommunistischen und faschistischen Arbeitern. Doch längst nicht alle Arbeiter waren so kämpferisch und klassenbewusst wie die Arbeiter aus dem Roten Solingen, die bei der Reichstagswahl im November 1932 mit 41,4% zur stärksten Partei geworden waren und mit Hermann Weber sogar einen kommunistischen Bürgermeister hatten (der allerdings vom preußischen Staatsministerium nicht bestätigt wurde). Der Berührungspunkt zwischen kommunistischen und faschistischen Arbeitern war das Kleinbürgertum, dass zwischen beiden Bewegungen hin und her schwankte. Und genau dieses politisch unentschiedene Kleinbürgertum hatte Clara Zetkin in ihrer Rede über die Gefahren des Faschismus 1923 im Blick, als sie sagte: „Der Träger des Faszismus ist nicht nur eine kleine Kaste, sondern es sind breite, soziale Schichten, große Massen, die selbst bis in das Proletariat hineinreichen.“ (15) Eine „Grand Old Dame“ wie Clara Zetkin konnte sich eine solche politische Analyse leisten und damit den klassenbewussten und siegesgewissen Proletarier, wenn auch nicht beerdigen, so aber doch kräftig relativieren.
Für die Gegenwart ist kaum bekannt, dass das Grundgesetz mit Art. 139 rechtsverbindlich formuliert: „Die zur ‚Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus‘ erlassenen Rechtsvorschriften werden von den Bestimmungen dieses Grundgesetzes nicht berührt.“ Dieser Artikel bezieht sich auf Gesetz Nr. 104 des Länderrates des amerikanischen Besatzungsgebietes, das im Laufe des Jahres 1946 auf alle Besatzungszonen übertragen wurde. Diese sog. Alliierten Vorbehaltsgesetze werden in der juristischen Fachliteratur unterschiedlich bewertet. Eine Position besagt schlicht und einfach, dass Art. 139 GG obsolet sei und eine andere Position sagt, dass man in einer liberal-demokratischen Demokratie nicht einseitig nur eine rechte Weltanschauung verbieten könne; wenn Art. 139 den Faschismus untersage, dann müsse ein solches Verbot auch für den Kommunismus gelten. Doch beide Interpretationen gehen am Wortlaut dieses Grundgesetzartikels vorbei. Art. 139 GG gehört neben anderen Artikeln des Grundgesetzes, besonders 1 und 20, zum Normbestand des Grundgesetzes. (16)
Auch und gerade vor dem Hintergrund von Art. 139 GG, müssen wir erschrocken zur Kenntnis nehmen, dass die AfD in einer Wählerumfrage des Instituts YouGov von Ende September 2025 mit 27% bundesweit zum ersten Mal vor der CDU liegt, (17) dass die SPD bei der Bundestagswahl 2025 720.000 frühere Wähler an die AfD abgegeben hat, dass in dieser Wahl die AfD bei den Zweitstimmen in Gelsenkirchen, einer alten Hochburg der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung, mehr Stimmen als die SPD hatte und dass die AfD ihren Stimmenanteil bei der Kommunalwahl in NRW in diesem Jahr auf 29,8% erhöhen konnte. Was für Gelsenkirchen gilt, trifft ähnlich auch auf Solingen zu. Bei der Kommunalwahl NRW vom 13. September 2025 holte „die mit Abstand meisten Stimmen […] die AfD von früheren SPD-Wählern.“ (18) Möglicherweise lässt sich zeigen, dass die heutigen AfD-Wähler Enkel und Kinder unter den Sozialisationsbedingungen ihrer vormaligen NSDAP-Väter und -Großväter aufgewachsen sind. Insider schätzen den AfD-Anteil an Mitgliedern der IG Metall auf rund zehn Prozent und inzwischen gibt es erste Betriebsratsvorsitzende der AfD. Die AfD hat inzwischen die SPD als Arbeiterpartei abgelöst, nicht als proletarische, aber als kleinbürgerliche Kraft, (19) während sich die SPD zu einer Partei des aufstiegsorientierten Mittelstandes der Angestellten verändert hat. Viele Fakten und Analysen sprechen außerdem dafür, dass die extreme Rechte dabei ist, sich in den Mainstream der politischen Kultur zu verwandeln. (20)
Diese soziologischen Bewegungen vom Arbeiter zum Kleinbürger stehen im Mittelpunkt des Buches „Rückkehr nach Reims“ des französischen Soziologen Didier Eribon. Für Nordfrankreich zeigt Eribon dasselbe, was Martin Becker mit seinem Roman „Die Arbeiter“ für den Oberbergischen Kreis schildern kann: Dieser Wechsel kann in ein oder zwei Generationen stattfinden. (21) Bei den Sinus-Milieus gibt es seit längerem kein proletarisches Milieu mehr. (22) Das dort gemessene Milieu der Unterschicht und der unteren Mittelschicht setzt sich aus drei Submilieus zusammen: Das prekäre Milieu beträgt mit 6,4 Mio. Menschen 9%, das traditionelle Milieu umfasst mit 11 Mio. Menschen 11% und das hedonistische Milieu ist mit 10,4 Menschen das stärkste Milieu und ihm entspricht ein Prozentsatz von 15%.
Was tun?Lenins Frage konnte 1902 mit Kraft, Zuversicht und revolutionärem Mut gestellt werden und wurde mit der Oktoberrevolution 1917 mit einem welthistorisch neuen utopischen Entwurf beantwortet.
Das geht heute – und im Übrigen seit langem – nicht mehr. Nicht einmal eine zweite sozialdemokratische Abpufferung der ungebremsten Vorherrschaft des internationalen Kapitals, wie zwischen 1960 und 1990, ist denkbar oder machbar. Die berufliche Herkunft von Bundeskanzler Merz als früherem Aufsichtsratsvorsitzenden des US-amerikanischen weltweit größten Vermögensverwalters BlackRock in Deutschland steht für die gegenwärtig eigentliche Zeitenwende, nicht etwa im Sinne des früheren Bundeskanzlers Scholz als neuer deutscher Militärpolitik. Vielmehr meint die eigentliche Zeitenwende die Ablösung eines altertümlichen Kapitalismus an Rhein und Ruhr durch politisch nicht kontrollierte internationale Investmentfonds wie BlackRock, Bakersteel oder Fidelity und um die fünf weltweit größten internationalen Tech-Konzerne wie Apple, Amazon, Google, Facebook und Microsoft. Und die eigentliche Zeitenwende zeigt sich in der Politik dort, wo ein autokratisch-populistisch-faschistoider Präsident wie Donald Trump aus den USA eine Herrschaftsallianz mit Tech-Milliardären wie Elon Musk (Tesla) oder Peter Thiel (Palantir) eingeht. Der deutsch-österreichische Schriftsteller Daniel Kehlmann geht bezüglich der USA unter Donald Trump so weit, dort von „offenem Faschismus“ (23) zu reden. (24)
Vorweg: Ich bin in meinem Leben politisch fast hilflos geworden und weiß auf die Frage „Was tun?“ fast keine Antwort mehr. Eine minimalistische Antwort ist soziales Engagement mit ehrenamtlichen Aufgaben auf nachbarschaftlicher, kirchlicher und kommunaler Ebene. Es geht also um eine Stärkung der caring communities. Aber diese grundsätzliche und zeitlose Antwort betrifft nur Individuen und selbst die Addition von Vielen kann nie das Ganze erreichen, bleibt also gesamtgesellschaftlich irrelevant.
Für eine politische und gesamtgesellschaftliche Ebene kann ich nur noch abstrakte Größen und Werte angeben und die führen mich zum antifaschistischen Widerstandskämpfer Wilhelm Leuschner zurück, der im Übrigen von meinem akademischen Lehrer Wolfgang Abendroth sehr geschätzt wurde. Die zentrale Botschaft von Wilhelm Leuschner hieß, dass man nur in großer Solidarität und Einheit handeln könne. Tragisch sind in diesem Zusammenhang seine letzten Worte kurz vor seiner Ermordung durch die Nazis am 29. September 1944 – also gestern vor 81 Jahren. Blutüberströmt kam er aus der Folterkammer zurück und konnte seinen Freunden nur noch zurufen: „Morgen werde ich gehängt, schafft die Einheit!“ (25) Wilhelm Leuschner meinte damals die Einheitsgewerkschaft, doch sein Aufruf nach einer Einheit gilt allen antifaschistischen Kräften, auch heute noch. Gegen Faschismus, AfD und gegen Rechtsextremismus hilft nur solidarisches und gemeinsames Handeln aller demokratischen Kräfte, also der Gewerkschaften, der Kirchen, aller demokratischen Parteien, natürlich inklusive Linke, BSW und MLPD, vieler NGOs von konservativen Gruppen wie dem Deutschen Hausfrauen-Bund oder dem Bund der Heimatvertriebenen über Pro Asyl, Greenpeace, Amnesty International bis hin zu Gruppen wie Fridays for Future, extinction rebellion, Letzte Generation oder Gelbwesten. Kurz: Die gesamte Zivilgesellschaft ist aufgefordert, solidarisch gegen die AfD zu handeln.
Es ist mir ein besonderes Anliegen heute auch auf eine verfassungsrechtliche Lücke zu verweisen, die seit langem besteht und die es endlich zu schließen gilt. Art. 14 GG legt die Sozialbindung des Eigentums fest und Art. 20 GG definiert unsere Republik als Sozialstaat. Beide Artikel sind das Fundament unserer Republik und deswegen unterliegt Art. 20 sogar der sog. Ewigkeitsgarantie und kann auch nicht mit einer parlamentarischen Mehrheit geändert werden. Auch Wilhelm Leuschner war der Sozialstaat ein wichtiges Anliegen. 1929 schrieb er, dass die Weimarer Verfassung die „Tür öffnet für den Vormarsch zur sozialen Republik […]. Das Ziel heißt, aus der politischen die soziale Demokratie zu machen, die politische und soziale Gerechtigkeit zu ergänzen und zu vollenden durch die Sicherung der wirtschaftlichen Gerechtigkeit für alle Volksgenossen im Volksstaate wie das z. B. in der Forderung nach Wirtschaftsdemokratie einen Ausdruck gefunden hat.“ (26) Art. 14 und Art. 20 wären gegenwärtig so zu konkretisieren, dass man die anwachsende Armutskluft mit 20% armen Menschen und den von SPD-Kanzler Gerhard Schröder geschaffenen Niedriglohnsektor abschafft. Zu konkretisieren wäre die Sozialbindung des Eigentums von Art. 14 GG bei Grund und Boden so, dass der Raubtierkapitalismus der Baukonzerne nicht länger billige Wohnungen verhindern kann. Beide Grundgesetzartikel zusammengenommen sind aber noch nicht so radikal wie Leuschner, der ja 1929 eine Wirtschaftsdemokratie forderte, d. h. die politische Parität von Arbeit und Kapital – und nicht zufällig ist es eine Gewerkschaft wie die IG Metall, die bis auf den heutigen Tag in § 2 ihrer Satzung eine „Demokratisierung der Wirtschaft unter Fernhaltung von neofaschistischen, militaristischen und reaktionären Elementen“ fordert.
In der deutschen Geschichte gab es nur zweimal Mal einen Generalstreik und zwar während des Kapp-Putsches 1920 und 1948 gegen Preiserhöhungen und das vom CDU-Politiker Ludwig Erhard propagierte Modell einer Marktwirtschaft. Solche Methoden der sozialen Verteidigung wie ziviler Streik, Widerstand, ziviler Ungehorsam, Boykott, Sabotage und Demonstrationen sind zu studieren und zu lernen. Einen kleinen Anfang in dieser Richtung zeigte der CDU-Bürgermeister Thomas Kufen von Essen, der sich 2025 mehrfach mit Gruppierungen der Sozialen Verteidigung traf. (27) Im Übrigen „haben alle Deutsche das Recht zum Widerstand“, wenn die Ordnung des „demokratischen und sozialen Bundesstaates“ beseitigt wird und „wenn andere Abhilfe nicht möglich ist“. Diese Sätze stehen ebenfalls in Art. 20 GG. Und in der Hessischen Verfassung gibt es mit Art. 147 sogar eine Widerstandspflicht.
Ein erstes kleines Beispiel von Zivilcourage zeigte sich in meiner Stadt Solingen, als sich nach dem geheimen AfD-Treffen in Potsdam, bei dem es um die sog. Remigration von deutschen Migranten ging, am 28. Januar 2024 spontan eine Demonstration auf dem Neumarkt mit 5.000 Personen bildete, die größte Demonstration Solingens der letzten Jahre. Auffallend war nicht nur die Größe, sondern erstens auch das Bekenntnis vieler Teilnehmer, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben an einer politischen Demonstration teilnehmen würden und zweitens der Witz vieler Demonstranten, die auf ihren selbst gebastelten Plakaten Slogans verkündeten wie „Keine Pizzas für die AfD“ und „Nazis essen heimlich Döner“. Die Witze auf vielen Plakaten machen auf ein Moment von zivilem Widerstand aufmerksam, mit dem die Herrschenden nicht umgehen und es auch nicht befrieden können, nämlich Witz, Tücke, Trug, List, Spott, Ironie, Satire, Sarkasmus, Zynismus und Demaskierung der Herrschenden durch Klamauk und Lächerlichmachung. Hierzu kennt die Literatur (28) viele berühmte Beispiele: das Narrenschiff von Sebastian Brant (1494), das Volksbuch Till Eulenspiegel (1510), des Kaisers neue Kleider von Hans Christian Andersen (1837), der brave Soldat Schwejk von Jaroslav Hašek (1921), der Felix Krull von Thomas Mann (1922), die Dreigroschenoper von Bertolt Brecht (1928) oder der Hauptmann von Köpenick von Carl Zuckmayer (1931).
Ein zweites Beispiel von zivilem Widerstand zeigte sich in Solingen nach der Ermordung von fünf türkischen Frauen und Mädchen durch Nazis 1993. Während die Stadtspitze den Bau eines Denkmals zur Erinnerung an diese Morde mit der vordergründigen Begründung ablehnte, ein solcher Ort könne ein Magnet für Nazis werden, baute die Jugendhilfe-Werkstatt ein solches Denkmal aus eigenem Antrieb und baute es auf dem Vorplatz einer großen Schule auf. Gedachten vor diesem Denkmal, das ein Hakenkreuz kaputtmacht, an den ersten jährlichen Gedenktagen nur kleine Teile der Solinger Zivilgesellschaft, so wurde dieses Alternativ-Denkmal seit langem von der offiziellen Stadtpolitik Solingens übernommen und ist heutzutage jährlicher Treffpunkt von Präsidenten, Botschaftern und Bürgermeistern mit fest ritualisierten Reden und Kranzniederlegungen.
-------------------------------
Quellen
(1) Zit. nach Klos, Sandra und Vogel, Isolde: Der historische Vergleich: Erkenntnisgewinn und Kampfzone, in: H-Soz-Kult, 28. Februar 2023, https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/fdkn-134070 (Abruf am 19. August 2025).
(2) Damit stelle ich mich gegen einen Autor wie Philipp Ruch: Es ist 5 vor 1933, München: Ludwig Buchverlag 2024. Einige Argumente meines Aufsatzes verdanke ich dem Vortrag von Kreutz, Daniel: Vor neuen 33? Vortrag auf der ökosozialistischen Konferenz der Internationalen Sozialistischen Organisation am 2. Juni 2025 in Köln.
(3) Vgl. Fromm, Rainer: „Wehrsportgruppe Hoffmann“. Darstellung, Analyse und Einordnung. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen und europäischen Rechtsextremismus, Frankfurt: Peter Lang Verlag 1998.
(4) Vgl. Lückenlos e. V. (Hrsg.): Wir klagen an! Anklage des Tribunals „NSU-Komplex auflösen“. 3. Aufl., Köln: NSU-Tribunal 2017.
(5) Vgl. Agnoli, Johannes: Die Transformation der Demokratie und verwandte Schriften, Hamburg: Konkret 2004 [Original: 1967].
(6) Vgl. Katz, Richard S. und Mair, Peter: Democracy and the cartelization of political parties, Oxford: Oxford University Press 2018.
(7) Vgl. Rügemer, Werner: Verhängnisvolle Freundschaft. Wie die USA Europa eroberten. Erste Stufe: Vom 1. zum 2. Weltkrieg, Köln: Papyrossa 2023. Ich danke meinem Freund Werner Rügemer für viele Anregungen in diesem Kapitel.
(8) Nur noch 49% aller Arbeitnehmer haben Arbeitsplätze mit Tarifbindung, 11% aller Erwerbstätigen arbeiten in einem Minijob und 2% aller Erwerbstätigen arbeiten als Leiharbeiter. Im Niedriglohnsektor arbeiten 6 Mio. Menschen. Langfristig geht die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder seit Anfang der 1990er Jahre zurück. Von allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sind nur rund 15% gewerkschaftlich organisiert.
(9) Langhoff, Wolfgang: Die Moorsoldaten. Ein Bericht. 13 Monate Konzentrationslager, Berlin: Aufbau-Verlag 1947, S. 227 und 249; ders.: Ein guter Kamerad, in: Neues Deutschland, 29. September 1946.
(10) In der Satzung der IG Metall von 1950 ist die Rede von einer „Bereinigung der Wirtschaft von nationalsozialistischen, militaristischen und reaktionären Elementen“ und Mitglieder der IG Metall dürfen nicht „ehemalige Mitglieder der NSDAP“ sein, „die sich durch ihr Verhalten an den Maßnahmen und Verbrechen der Nationalsozialisten beteiligt haben.“ Ein Wechsel des Adjektivs von „nationalsozialistisch“ zu „neofaschistisch“ fand in den Satzungsversionen der IG Metall Mitte der 1950er Jahre statt. Im Vergleich zur Satzung der IG Metall von 1950 ist die Satzung von Verdi von 2001 unpolitisch. Wenn dort in § 5 steht, dass sich Verdi „zu Grundsätzen des demokratischen und sozialen Rechtsstaates“ bekennt, dann ist das nicht mehr als eine inhaltslose Floskel, wie sie tagtäglich irgendwo ohne Sinn und Verstand aufgesagt wird. Die zeitliche Differenz von 1950 bis 2001 steht gleichzeitig für eine Entpolitisierung der deutschen Bevölkerung.
(11) Vgl. Abendroth, Wolfgang: Ein Leben in der Arbeiterbewegung, Frankfurt: Suhrkamp 1976, S. 115f.
(12) Jones, Mark: 1923. Ein deutsches Trauma, Berlin: Zentrale für politische Bildung 2022, S. 262.
(13) Vgl. Leuschner, Wilhelm: Rede vor den Neuwahlen zum Hessischen Landtag am 30. Mai 1932 in: Brandt, Willy (Hrsg.): Das Gewissen steht auf. 64 Lebensbilder aus dem deutschen Widerstand 1933-1945, Frankfurt: Büchergilde Gutenberg 1963, S. 97.
(14) Vgl. https://www.rnd.de/politik/roland-koch-zu-deutschlands-politik-wer-afd-waehlt-macht-die-republik-linker-STLHEAZ5LJDULLUDWK2SLEMYWE.html (Abruf am 13. September 2025).
(15) Zetkin, Clara: Rede auf der Konferenz der erweiterten Exekutive der Kommunistischen Internationale, Moskau, 12. – 13. Juni 1923, in: Nolte, Ernst (Hrsg.): Theorien über den Faschismus, Königstein: Athenäum 1984, S. 88-111; hier S. 89.
(16) Vgl. Stuby, Gerhard: Bemerkungen zum verfassungsrechtlichen Begriff „freiheitliche demokratische Grundordnung“, in: Abendroth, Wolfgang u. a.: Der Kampf um das Grundgesetz. Über die politische Bedeutung der Verfassungsinterpretation. Referate und Diskussionen eines Kolloquiums aus Anlass des 70. Geburtstages von Wolfgang Abendroth, Frankfurt: Syndikat 1977, S. 114-132.
(17) Vgl. Solinger Tageblatt, 18. September 2025, S. 4. Auf methodisch oft fragwürdige Umfragen von YouGov und dessen dubiose Besitzstruktur möchte ich an dieser Stelle nicht eingehen.
(18) Zit. nach Solinger Tageblatt, 20. September 2025, S. 15.
(19) Vgl. Peters, Benedikt: Viel zu verlieren. Keine Partei kommt bei Arbeiterinnen und Arbeitern so gut wie die AfD. Woran liegt das? Eine Spurensuche, in: Süddeutsche Zeitung. 30./31. August 2025, S. 7.
(20) Vgl. Rauscher, Hans: Die extreme Rechte ist bereits Mainstream, in: Der Standard [Österreich], 9. September 2025.
(21) Vgl. Eribon, Didier: Rückkehr nach Reims, Berlin: Suhrkamp 2016 und Becker, Martin: Die Arbeiter. Roman, München: Luchterhand 2024.
(22) Noch in den ersten Arbeiten des Sinus-Instituts Ende der 70er bis Mitte der 90er Jahre maßen die Milieustudien zwei Arbeitermilieus: das traditionelle und das traditionslose (Entwurzelte) Arbeitermilieu. Doch da Sinus kein Schichtenmodell/keine Klassen abbildet, sondern Lebensstile mit Wertedimensionen, veränderten sich im Laufe von Zeit die soziokulturellen Gruppen. Im aktuellen Sinus-Milieumodell gibt es drei unterschichtige Milieus, denen in der einen oder anderen Form ein proletarischer Lebensstil zugeschrieben werden kann: das traditionelle Milieu, das prekäre Milieu und das Konsum-Hedonistische Milieu.
(23) Zit. nach Anne-Catherine Simon: „Der liberale Staat hat mich verraten“, in: Die Presse [Österreich], 6. September 2025, S. 25.
(24) Bei dem schwierigen Versuch, Faschismus zu definieren, erlaube ich mir hier den Hinweis darauf, dass Albert Einstein, Hannah Arendt und viele andere jüdische Intellektuelle nach dem Massaker an rd. 100 Palästinensern in dem Dorf Deir Yassin durch den israelischen Juden Menachem Begin und seine Anhänger am 9. April 1948 diesen einen Faschisten genannt hatten. Vgl. ihren Leserbrief in der „New York Times“ vom 4. Dezember 1948. Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_von_Deir_Yasin (Abruf am 20. September 2025).
(25) Diese (auch angezweifelte) Äußerung wird hier zitiert nach Buchwitz, Otto: 50 Jahre Funktionär der deutschen Arbeiterbewegung. 3. Aufl., Berlin: Dietz 1958, S. 167.
(26) Leuschner, Wilhelm: Vom deutschen Volksstaat. Die Bedeutung der Weimarer Verfassung, in: Reiber, Julius und Storck, Karl (Hrsg.): Zehn Jahre Deutsche Republik. Ein Gedenkbuch zum Verfassungstag 1929, Darmstadt: Verlagshaus-Darmstadt Wolfgang Schröter 1929, S. 25-31; hier: S. 30.
(27) Vgl. Arnold, Martin: Wehrhaft ohne Waffen – Regionalgruppe Essen. Von der Gründung bis zur Zusammenarbeit mit der Stadt Essen, in: Wissenschaft und Frieden, Dossier 101. Beilage der Zeitschrift Wissenschaft & Frieden, 3/2025, S. 20-22.
(28) Vgl. auch Arendt, Dieter: Der Schelm als Widerspruch und Selbstkritik des Bürgertums. Vorarbeiten zu einer literatur-soziologischen Analyse der Schelmenliteratur, Stuttgart: Klett 1974.
Ein entscheidender Zeitpunkt für unseren unabhängigen journalistischen Kanal steht bevor. Morgen um 12:00 Uhr veröffentlicht unser Gründer Zain Raza ein Statement zur aktuellen Lage und zu Entwicklungen, die unmittelbare Auswirkungen auf die Zukunft von acTVism haben. Wir empfehlen, für die Premiere eine Benachrichtigung zu aktivieren, um den Start nicht zu verpassen. Weitere Informationen werden nach […]
Der Beitrag Steht acTVism Munich vor dem Ende? | Botschaft von Zain Raza erschien zuerst auf acTVism.
In seinem neuesten Bericht analysiert Dimitri Lascaris die Pressekonferenz, die Donald Trump und der designierte Bürgermeister von New York City, Zohran Mamdani, am 21. November abgehalten haben. Er stellt sich die Frage, warum Trump plötzlich den neuen Bürgermeister von New York City liebt. Lascaris untersucht anschließend das zunehmend katastrophale Image Israels in der Welt und […]
Der Beitrag Trumps Liebe zu Mamdani & Israels radioaktives Image erschien zuerst auf acTVism.
In diesem Video, das exklusiv auf Deutsch auf unserem Kanal veröffentlicht wurde, untersucht der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Journalist Glenn Greenwald, wie der Außenminister der Vereinigten Staaten, Marco Rubio, im Alleingang den vorgeschlagenen 28-Punkte-Friedensplan zur Beendigung des Krieges zwischen der Ukraine und Russland sabotiert hat. Dieses Video wurde von System Update produziert und am 26. […]
Der Beitrag Wie Marco Rubio das Friedensabkommen mit der Ukraine sabotierte erschien zuerst auf acTVism.
Das britische Fernsehen strahlte eine Dokumentation aus, in der israelische Soldaten über die Kriegsverbrechen berichten, die sie in Gaza begangen haben. Sie erläutern ihre Beweggründe und Motive. Eine Mauer des Schweigens in der israelischen Gesellschaft ist gebrochen, und das Ausmaß traumatischer Schuldgefühle israelischer Soldaten beginnt sich zu zeigen. Der Grund für das Brechen der Mauer […]
Der Beitrag Israelische Soldaten sagen zu Kriegsverbrechen aus erschien zuerst auf acTVism.
In diesem Video, das exklusiv auf Deutsch auf unserem Kanal veröffentlicht wurde, interviewt der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Journalist Glenn Greenwald Guy Christensen, einen jungen politischen Aktivisten und TikTok-Influencer, der sich zu einer prominenten Stimme für die palästinensischen Anliegen und zum Kritiker der israelischen Aktionen im Gazastreifen gemacht hat. Das Interview befasst sich auch mit […]
Der Beitrag Was man auf TikTok nicht sagen darf: Zensur & politische Repression erschien zuerst auf acTVism.
In diesem Video, das exklusiv auf Deutsch auf unserem Kanal veröffentlicht wurde, untersucht der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Journalist Glenn Greenwald den Mordversuch an dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump im Jahr 2024 und die mangelnden Informationen des FBI über den Attentäter. Er kritisiert die Ablehnung des FBI, zu kooperieren und Transparenz zu schaffen. Dieses Video […]
Der Beitrag Verheimlicht das FBI Informationen über den Attentäter von Trump? erschien zuerst auf acTVism.
Am Montag, dem 17. November, verabschiedete der UN-Sicherheitsrat eine Resolution, die Donald Trumps sogenannten „Friedensplan“ für Gaza befürwortet. Die Resolution billigt die Schaffung eines von den USA geführten „Friedensrats“ zur Beaufsichtigung des Gazastreifens, fordert die „Entmilitarisierung“ Gazas, ohne Israel irgendwelche Beschränkungen hinsichtlich seiner Bewaffnung aufzuerlegen, und ermächtigt eine „internationale Stabilisierungstruppe“, palästinensische Widerstandsgruppen zu überwachen und […]
Der Beitrag UN-Resolution zu Gaza – ‘Gräueltat’, warnt Ex-UN-Menschenrechtschef Craig Mokhiber erschien zuerst auf acTVism.
Das deutsche Exportmodell steckt in einer Existenzkrise. Eine blockierte Transformation und Elektrorevolution, zwei Jahre konsekutives Negativwachstum, die Schließung und Verlagerung von Industrieunternehmen und damit der massenhafte Abbau von Industriearbeitsplätzen sprechen Bände. Dasselbe gilt für die Zunahme schutzzöllnerischer Vorgehensweisen im Westen, die andeuten: Eigentlich wollten deutsche Automobil- und andere Konzerne den chinesischen Markt erobern, heute nehmen sie den deutschen Staat in die Pflicht zu schützen, was sie schon haben. Die EU steckt im Zangengriff aus hyperwettbewerbsfähiger chinesischer Wirtschaft und Trumps Triumph im Zollstreit mit der EU. Was gegen die Volksrepublik misslang, war an Machtpotenzial für die Europäische Union noch gut genug.
In dieser Situation verspricht die Bundesregierung, dass die größte Aufrüstungswelle seit Ende des Zweiten Weltkriegs zu wirtschaftlichem Wachstum führen werde. Auf der Tagung „Wirtschaftsfaktor Rüstung“, die das Handelsblatt im Sommer veranstaltete, versprach Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), dass die Aufrüstung „auch eine wirtschaftliche und eine technologische Chance für Deutschland“ (1) sei. Einer der zentralen Stichwortgeber der Aufrüstung in Funk und Fernsehen, Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr in München, versprach in der FAZ (2), die Aufrüstung werde zum „Jobmotor“. Moritz Schularick, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft, erwartet im Ergebnis der Rüstungsausgaben immerhin ein Wachstum von 1,5 Prozent für den gesamten Euroraum.
Auch im IPG-Journal der Friedrich-Ebert-Stiftung, der parteinahen Stiftung der im Bund regierenden SPD, verspricht man sich von der Aufrüstung positive Wachstumseffekte. Die IG Metall wiederum sieht sich mit einer Situation konfrontiert, in der an die Stelle von Arbeitsplätzen in der Automobilindustrie und bei ihren Zulieferern nun solche bei den Rüstungskonzernen treten: Ganze Volkswagen-Werke sollen, wie in Osnabrück, in Rheinmetall-Werke umgewidmet werden (3), in Görlitz werden künftig statt Straßenbahnen Panzerfahrzeuge gebaut, auch in Gifhorn, Salzgitter und an anderen Standorten droht eine solche Umwandlung von ziviler in Militärproduktion. Manchem erscheint die Aufrüstung darum als Antidot zur Deindustrialisierung.
Wachstumsmotor Hochrüstung?Was ist nun von diesen Versprechungen zu halten? Ist Rüstungskeynesianismus ein Ausweg aus der Krise der Wirtschaft? Kann an die Stelle des existenzkriselnden Exportmodells nun Hochrüstung als makroökonomisches Allheilmittel treten? Sichert die Aufrüstung kurzfristig Arbeitsplätze, ganz nach dem Keynes’schen Motto: „In the long run we are all dead“, womöglich in einem großen Krieg, aber kurzfristig lassen wir es nochmal krachen? Tatsächlich ist, selbst wenn man ihrer instrumentellen Logik folgt, die Gleichung Aufrüstung gleich Deindustrialisierungsantidot, rein ökonomisch betrachtet, kurzsichtig – und zwar aus sechs Gründen:
Erstens: Insofern die USA den hochgradig monopolisierten Weltmarkt für Rüstungsgüter dominieren – die fünf größten Rüstungskonzerne der Welt sind alles US-amerikanische –, bedeuten die Hochrüstungsmaßnahmen letzten Endes, dass die europäischen Arbeiterklassen mit ihren Steuergeldern die Profite von Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing und Co (4). und die Dividendenausschüttungen an deren Aktionäre finanzieren. Sie bedeuten, dass die europäischen Staaten, ja alle US-Verbündeten ein militärkeynesianisches Rüstungsprogramm finanzieren, aber nicht für sich selbst, sondern in weiten Teilen für die USA. Wirtschaftspolitisch betrachtet könnte man genauso gut Milliardensummen ohne Gegenleistung an Donald Trump überweisen.
Zweitens: Staatliche Ausgaben – militärische wie zivile – führen immer und überall zu direktem und indirektem Wachstum: Investitionen in Rüstung kurbeln die Stahlproduktion an, Investitionen in Gesundheit die Pharmazeutik usw. Das Besondere an Rüstungsausgaben ist jedoch: Sie sind tote Konsumtion. Rüstung funktioniert im Kern wie schlichter Massenkonsum, etwa durch das Versenden von Schecks an die Bevölkerung, die einfach konsumtiv ausgegeben werden. Denn einmal produziert, liegen die Waffen herum; es sei denn, sie kommen in einem Krieg zum Einsatz und es entsteht, wie im militärisch-industriellen Komplex der USA, Dauerbedarf. In jedem Fall erweitern Investitionen in Waffen nicht das kapitalistische Wachstum auf höherer Stufenleiter.
Investitionen in Bildung, Gesundheit, Klimaschutz oder eine andere Industriepolitik versprechen eine deutlich größere konjunkturelle Wirkung, da ihnen ein höherer Multiplikatoreffekt innewohnt, der sich in Form von Arbeitsplätzen, neuen Wachstumsbranchen und Ähnlichem niederschlägt. Jüngere vergleichende politökonomische Forschung zeigt: Investitionen in Umwelt, Bildung und Gesundheit erzeugen in Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien höhere Wachstumsimpulse. Auch in den USA liegt der Multiplikatoreffekt bei Bildung und Gesundheit über dem der Rüstung – lediglich Umweltinvestitionen schneiden dort schlechter ab.
In Deutschland ist das Wachstum durch staatliche Ausgaben für Bildung und Gesundheit fast dreimal so hoch wie bei Rüstung und bei Umweltinvestitionen immer noch fast doppelt so hoch. In Italien entstehen pro eine Million Euro Ausgaben des öffentlichen Sektors drei Arbeitsplätze durch Rüstung, im Bildungssektor dagegen elf.
Je stärker also Investitionen in Umwelt, Bildung und Gesundheit zugunsten des Schuldendienstes für die Aufrüstung gekürzt werden, desto stärker verteilt die Rüstungsproduktion das Wachstum zuungunsten der Beschäftigten: Dem erhofften BIP-Wachstum von 1,5 Prozent stehen geplante Rüstungsausgaben von 3,5 Prozent des BIP gegenüber. Die EU rechnet für Deutschland im nächsten Jahr nun mit einem Wachstum von 1,1 Prozent, die Wirtschaftsweisen haben dies weiter nach unten korrigiert (5), auf 0,9 Prozent.
Drittens: Auch der Beschäftigungseffekt der Kriegswirtschaft ist zu vernachlässigen und kann die Arbeitsplatzverluste in der zivilen Industrie (u.a. in der Autoindustrie) nicht auffangen. Im Allgemeinen ist wenigstens ein Wachstum von 2,5 Prozent vonnöten, um vor dem Hintergrund von Produktivitätssteigerungen und bei gleichbleibend hoher Arbeitszeit das Beschäftigungsniveau zu halten. Während heute also auch in der IG Metall diskutiert wird, ganze VW-Werke in Rheinmetall-Werke umzubauen, um statt Autos Kriegsgerät zu produzieren, sind die Erwartungen an den Beschäftigungseffekt der Hochrüstung eher gering: Neue Studien gehen von 200.000 neuen Arbeitsplätzen (6) aus, die in den nächsten Jahren in Deutschland entstehen könnten. Dagegen steht heute allein in der Autoindustrie, das heißt ohne Zuliefererbetriebe von der Metallerzeugung bis zur Software, der Abbau von 245.000 Stellen seit 2019 und allein 114.000 Stellen im vergangenen Jahr. (7) Hinzu kommt der Stellenabbau der Zulieferer, der sich allein in der Metallerzeugung im vergangenen Jahr auf 12.000 Stellen summierte. Dabei sind sich alle Experten einig, dass die Krise der Autoindustrie gerade erst begonnen hat. Umgekehrt erscheinen die Hoffnungen auf starke Beschäftigungseffekte durch die Waffenproduktion eher optimistisch, da die Panzerfertigung künftig zunehmend automatisiert wird und Kriegsführung zusätzlich immer stärker auf Drohnen verlagert wird.
Viertens: Aufrüstung geht auch zulasten ziviler Produktion. Die Folge ist die Verknappung von zivilen Konsumgütern. Die Folge der Angebotsverknappung wiederum ist Teuerung, Inflation, also ein sinkender Lebensstandard für die Arbeiterklasse. Dieser hat aber zwangsläufig Folgewirkungen für die aggregierte Nachfrage. Davor warnte vor dem Ersten Weltkrieg schon der österreichische Politökonom und Sozialdemokrat Otto Bauer: „Bei aller Sparsamkeit“ könne der Staat die Summen für die Aufrüstung niemals woanders „ersparen“. Das „Defizit“ werde also „natürlich immer größer, wenn die Ausgaben für den Militarismus so schnell wachsen“. Der Staat werde daher „die Steuern erhöhen müssen, um das Defizit zu decken“. Die Folge hiervon: „Wenn der Arbeiter mehr Steuern zahlen muss, kann er weniger für Kleider, Wäsche, Schuhe, Bücher ausgeben.“ Das würden dann aber wieder die Industriezweige, „die diese Waren erzeugen“, zu spüren bekommen; sie „werden weniger Arbeiter beschäftigen können, weil sie weniger Absatz haben“. Im Ergebnis: „Es werden mehr Arbeiter bei der Erzeugung von Mordwerkzeugen, dafür aber weniger Arbeiter bei der Erzeugung von Kleidern, Wäsche, Schuhen, Büchern beschäftigt werden!“ Die Aufrüstung ist also ein Nullsummenspiel, der „Militärkeynesianismus“ eine Scheinrechnung, auch rein ökonomisch betrachtet.
Fünftens: Die Einleitung einer Kriegswirtschaft behindert nun auch die Innovationsfähigkeit der Wirtschaft auf die Dauer. Denn sie verschiebt gesellschaftliche Ressourcen, Ingenieurs-Know-how, Hochschulforschung usw. weg von gesellschaftlichen Zielen wie dem Klimaschutz, der Mobilitätswende und der sozialen Gerechtigkeit, die nicht nur gesellschaftlich sinnvoller wären, sondern eben auch mit höheren Multiplikatoreffekten. Daraus ergibt sich auch eine weitere, alles entscheidende Konsequenz.
Nämlich sechstens: Rüstungspolitik ist kein Antidot zu Deindustrialisierung, sie ist ein Treiber von Deindustrialisierung. Kurz: Zwischen Aufrüstung und dem Verlust der industriellen Basis eines Landes besteht ein sehr enger Zusammenhang. Dies zeigt die Geschichte. Der Aufstieg Chinas wurde erleichtert durch die Tatsache, dass die Volksrepublik nach ihrem Bündnis mit den USA 1972/73 im Windschatten der Vereinigten Staaten sich rein auf die zivile Entwicklung konzentrieren konnte, während die Sowjetunion im „Second Cold War“ von den USA zu einer massiven Aufrüstungslast zulasten ihrer zivilen Produktion gezwungen und letztlich totgerüstet wurde. Die im Weltkrieg von den USA besiegten und besetzten (West-)Deutschland und Japan wurden nach 1945 zu den am weitesten entwickelten Ökonomien des Kapitalismus und zum Hauptkonkurrenten für die USA nicht bloß deshalb, weil ihre Infrastruktur zerstört war, sondern weil ihre Rüstungsausgaben konstant niedrig blieben. Großbritannien und Frankreich hatten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs stetig hohe Militärausgaben mit einer Spezialisierung in der Waffenproduktion, und im gleichen Maße erlebten sie eine schnellere Deindustrialisierung. Die Bundesrepublik Deutschland, Italien und Spanien hingegen weisen historisch vergleichsweise niedrigere Militärausgaben mit einer Spezialisierung in ziviler Produktion auf, und im Ergebnis vollzog sich der Prozess der Deindustrialisierung langsamer oder, im Falle der Bundesrepublik, fast gar nicht. Ein wesentlicher Grund: In Deutschland, Italien und Spanien war historisch der militärische Anteil der Ausgaben für Forschung und Entwicklung (R&D) sehr viel geringer als in Großbritannien und Frankreich.
Mit anderen Worten: Aufrüstung stürzt die EU in verschärftere, nicht geringere Deindustrialisierung, verlangsamt sie nicht, sondern beschleunigt sie. Sie ist sogar in ausschließlich ökonomischer Hinsicht ein schlechter Deal: Höhere Militärausgaben bedeuten weniger Wohlstand und weniger Arbeitsplätze.
Ein militärisch-industrieller Komplex und seine FolgenDie gesellschaftlichen Kosten und politischen Konsequenzen der Aufrüstung sind also gigantisch. Ein Ende des Niedergangs ist nicht in Sicht. Die deutsche Politik stellt die Bevölkerung längst darauf ein: Deutschland werde „buchstäblich ärmer“, sagte schon zu Beginn des Ukrainekriegs und der Sanktionspolitik der damalige Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Auch Friedrich Merz, damals noch CDU/CSU-Oppositionsführer und Bundeskanzler in spe, stimmte die Bevölkerung auf niedrigere Erwartungen ein. Die besten Jahre lägen hinter uns, sagte er damals und meinte damit natürlich nicht sich und seine Klasse. Nach der Wahl verknüpfte Kanzler Merz die Ankündigung der Hochrüstung mit der Ankündigung von massiven Sozialkürzungen und Lebensarbeitszeitverlängerungen: Das „Paradies“ sei vorbei.
Heute sagen Vertreter der Bundesregierung, dass die Rente „nicht mehr zum Leben reichen“ (8) werde, dass die Lohnabhängigen künftig bis 70 arbeiten (9) müssten und dass, wer das Renteneintrittsalter dann tatsächlich noch erreicht und nicht vorher schon aus Erschöpfung in die Grube fährt, dann auch seine Medikamente nicht mehr bezahlt (10) bekommen soll.
Die SPD hoffte, mit der Aufhebung der Schuldenbremse für die Rüstung dem Widerspruch Raketen oder Rente, Kampfschiffe oder Kindergärten, Schützenpanzer oder Schulen zu entkommen. Diese Rechnung wird nicht aufgehen. Industrieumbau, soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz werden mit der Hochrüstung unter die Räder kommen. Der Grund ist simpel: Die Kosten der Aufrüstung lassen sich zwar in die Zukunft verlagern und zukünftigen Generationen aufbürden, sofern ein großer Krieg verhindert wird und es diese dann noch gibt. Die Tilgung der Schulden aber, die mit der unbeschränkten Kreditaufnahme für die Aufrüstung entstehen, wird aus dem laufenden Haushalt geschehen müssen. Dierk Hirschel, Chefökonom der Gewerkschaft Verdi und Mitglied von DL21 in der SPD, hat in dem neuen Buch „Gewerkschaften in der inneren Zeitenwende“, das die IG-Metall-Gewerkschaftssekretärin Ulrike Eifler aus Würzburg herausgegeben hat, vorgerechnet, dass der Schuldendienst schon 2027 die finanziellen Spielräume für Ausgaben in allen anderen Bereichen – Arbeit, Bildung, Gesundheit, Rente – im Grunde ganz und gar austrocknen wird. Die Aufrüstung gerät in einen extremen Gegensatz zur Verteilung und zur sozialen Gerechtigkeit – genau das, was die Sozialdemokraten mit der Grundgesetzänderung eigentlich verhindern wollten.
Aber auch strukturell verändert die Hochrüstung das Gemeinwesen. Sie macht den Staat erpressbar. Dies wusste Otto Bauer ebenfalls längst, als er den Militarismus vor dem Ersten Weltkrieg kritisierte. Die Hochrüstung vergrößere, schrieb er seinerzeit, nämlich die „Abhängigkeit des Staates vom Großkapital“, woraus sich ergebe, dass der Staat dem Kapital dienstbar werde und dem Kapital für seine Kredite dankbar sein müsse. Die Regierung bedanke sich bei den Großkonzernen durch Willfährigkeit: Sie ermögliche durch Arbeitszeitgesetze eine ununterbrochene Produktion, schmettere die Forderungen der Sozialdemokratie nach dem Achtstundentag nieder und erfülle alle Kapitalbedingungen, wodurch die „Gesundheit der Arbeiter“ geschädigt und die „Zahl der Betriebsunfälle“ zunehme. Ergebnis: „Für die Unternehmer 50 Millionen Profit, für die Arbeiter zwölf- und 18-stündige Arbeitszeit“ – das sei der „volkswirtschaftliche Nutzen“ der Aufrüstung.
Wesentlich ist außerdem: Durch die Aufrüstung entsteht eine strukturelle Festlegung der deutschen Gesellschaft, die sich später nur schwer politisch korrigieren lässt. Nach innen wird die Gesellschaft von der Aufrüstung abhängig – es werden Geister gerufen, die sie nicht mehr loswird. Am Ende droht, wie in den USA, die Entstehung eines militärisch-industriellen Komplexes. Kommunen würden um Gelder aus den neuen Rüstungsausgaben in Höhe von fünf Prozent des BIP – das entspricht jedem zweiten Euro im Bundeshaushalt – konkurrieren, und die Wiederwahl von Politikern könnte davon abhängen, ob sie Rüstungsproduktion im eigenen Gebiet ansiedeln oder Mittel für die „Kriegstüchtigkeit“ der Infrastruktur sichern.
Ein einmal entstandener militärisch-industrieller Komplex muss ständig neue Gefahren erzeugen, Bedrohungsszenarien über Stiftungen, Denkfabriken und Medien verbreiten und Wege finden, die angeschafften Waffenarsenale zu nutzen oder zu zerstören. Das bedeutet – wie der US-Komplex zeigt – einen Zustand permanenter Kriegsführung.
----------------------------
Quellen:
(2) https://x.com/CarloMasala1/status/1894380659012989132
-----------------------
Der Betrag ist an 18. November 2025 in der Berliner Zeitung erschienen
Ingar Solty ist Autor und lebt in Berlin. Im Frühling erscheint sein neues Buch „Der postliberale Kapitalismus: Renationalisierung – Krise – Krieg“.