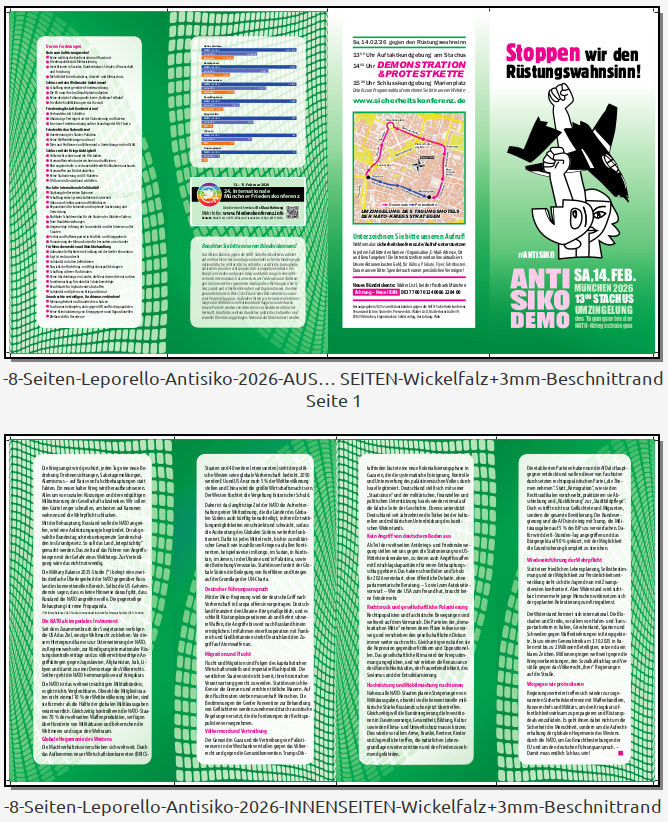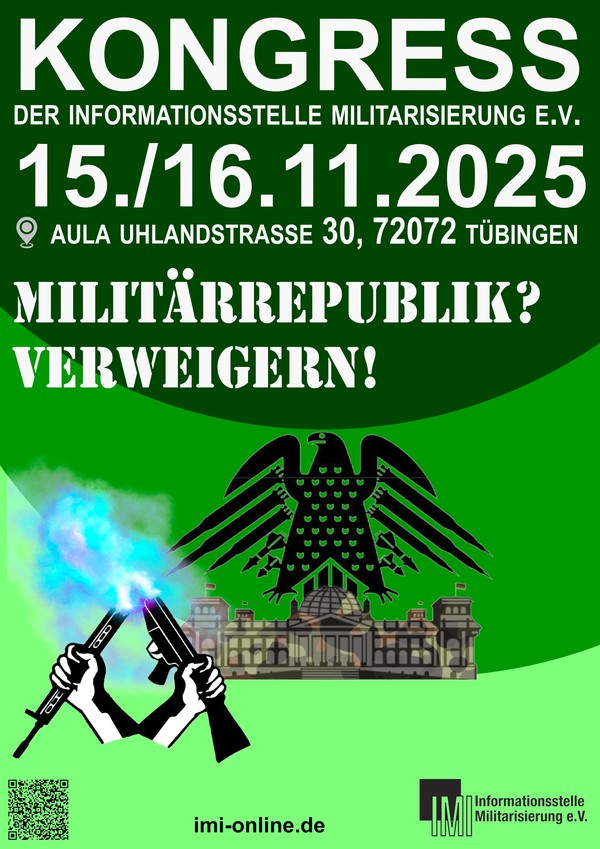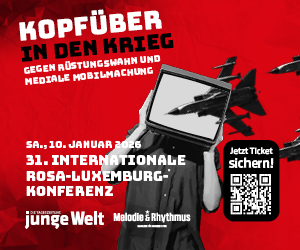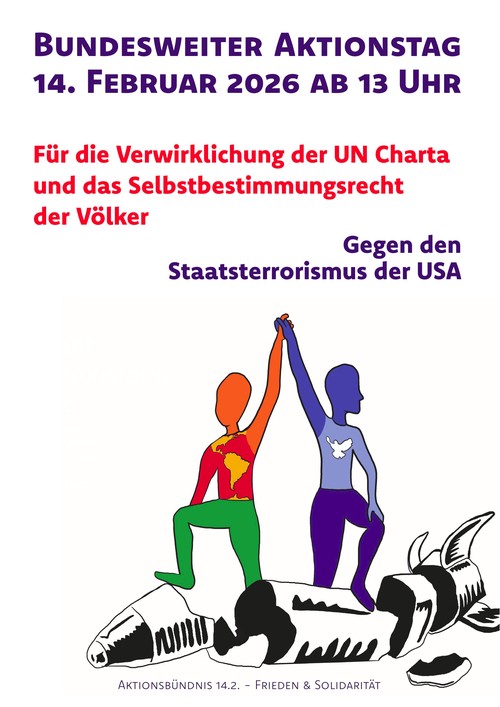Meldungen (Feeds)
Xinjiang: Boomregion nach erfolgreichem Kampf gegen Terrorismus
Falls im Westen und speziell im deutschen Sprachraum jemand überhaupt etwas mit dem Begriff “Xinjiang” verbinden kann, assoziiert der Name dieser chinesischen Provinz wahrscheinlich brutale Verfolgung und (kulturelle) Auslöschung einer ganzen Ethnie, der Uiguren. Die Uiguren sind ein Turk-Volk, meistens Muslime. Verfolgt und ausgelöscht von der chinesischen Regierung wegen ihrer Religion und weil sie keine Han-Chinesen sind. So jedenfalls die im Westen verbreitete Erzählung. Beispielhaft das Buch: “Ein Volk verschwindet. China und die Uiguren“ (1), 2022 erschienen und auch von der Bundeszentrale für politische Bildung an den Schulen etc. verbreitet. Geschrieben von einem Journalisten der Zeitschrift Wirtschaftswoche, der seine steile, marktgängige These kaum auf eigene Untersuchungen stützt, sondern auf dünne Belege zweiter und dritter Hand.
Als ich im Sommer die Einladung vom chinesischen Außenministerium bekam, an einer Reise von Journalisten und Publizisten durch Xinjiang teilzunehmen, war ich begeistert. Denn ich kenne zwar viele Teile Chinas und bin auch schon durch Tibet gereist, hatte bislang aber nie Gelegenheit, selbst nach Xinjiang zu kommen. Dabei können Bürger der meisten EU-Länder China und damit auch Xinjiang 30 Tage visumsfrei besuchen.
Zweifellos verfolgte das chinesische Außenministerium mit dieser Einladung die Absicht, international eine andere, positive Botschaft von der Lage in Xinjiang zu verbreiten. Mir war auch klar, wir würden keine Gefängnisse oder Arbeitslager sehen. Aber einmal sehen ist besser als tausendmal hören oder lesen. Ich wollte selbst einen Eindruck von der Situation in Xinjiang gewinnen. Ich wollte besser verstehen, was dran ist an den Berichten von der brutalen chinesischen Repression gegen die Uiguren. Binsenweisheiten wie: “Wo es Rauch gibt, gibt es auch Feuer!” oder "Die Wahrheit liegt in der Mitte.“ reichten mir nicht zur Beurteilung der Ereignisse der letzten 20 Jahre in Xinjiang und zur Einordnung der Horror-Stories über Xinjiang im Westen.
Mein Gesamteindruck aus den drei großen Städten, die wir besuchten (wir waren nicht in den ländlichen Regionen Xinjiangs): Das Leben ist nicht anders als sonstwo in China. Das gilt auch für die Polizeipräsenz und die angebliche Überwachung rund um die Uhr. Im Straßenbild mischen sich Menschen verschiedenster Ethnien. Straßenschilder, offizielle Aushänge etc. sind in Mandarin UND in arabischen Schriftzeichen. Xinjiang wird mit massiven staatlichen und privaten Investitionen entwickelt, den Menschen in der Provinz geht es vergleichsweise gut, sie haben eine Perspektive. Xinjiang mit seinen wundervollen Landschaften ist auch das Ziel von Millionen chinesischen Touristen.
Xinjiang: dreimal so groß wie Frankreich, aber nur 26 Millionen EinwohnerDie Reise war organisiert vom chinesischen Außenministerium zusammen mit der Regierung der uigurischen autonomen Region Xinjiang. Uiguren sind die größte ethnische Gruppe in Xinjiang. Deshalb der besondere Status von Xinjiang als autonomer Region gegenüber anderen chinesischen Provinzen. In der Reisegruppe waren 24 Journalisten, Schriftsteller und Medienvertreter aus 19 Ländern. Die achttägige Tour führte von der Provinzhauptstadt Ürümqi nach Südwesten ins 1.500 km entfernte Kaschgar (chinesisch: Kashi) mit mehrheitlich uigurischer Bevölkerung und in die Region Ily im Nordwesten von Xinjiang an der Grenze zu Kasachstan.
Xinjiang ist etwa dreimal so groß wie Frankreich; es nimmt über 17% der Fläche von ganz China ein. Es grenzt an die Äußere Mongolei, Russland, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Afghanistan und Pakistan. Es ist also “Grenzland", was auch der chinesische Begriff für die Region: Xinjiang = “neue Grenze“ reflektiert. Große Teile sind Wüste oder unwirtliche Hochgebirge; der zweithöchste Gipfel der Welt, der K2, liegt in Xinjiang. Das Gebiet ist dünn besiedelt mit nur 15 Einwohnern pro qkm. Zum Vergleich: In der Provinz Shandong an Chinas Ostküste leben 646 Menschen pro qkm. 2020 hatte Xinjiang knapp 26 Mio. Einwohner, davon 45% Uiguren, 40% Han-Chinesen, außerdem verschiedene andere Ethnien wie Hui, Kasachen, Kirgisen, Mongolen, Tadschiken, Usbeken, Russen und Tibeter.
Xinjiangs strategische Bedeutung in der Kaiserzeit und heuteZweifellos ist Xinjiang mit seiner exponierten Grenzlage zu Zentralasien und zum indischen Subkontinent und als Einfallstor ins chinesische Kernland ein begehrtes und umkämpftes geopolitisches Ziel. Für das bis 1911 existierende chinesische Kaiserreich war die Kontrolle und Sicherung der westlichen Grenzen deshalb immer eine strategische Aufgabe. Davon zeugen alte Festungen in der Gegend von Ily nahe der Grenze zu Kasachstan. Für jeweils fünf Jahre schickte der chinesische Kaiser Beamte aus Peking als Kommandanten nach Ily. Wenn sie sich bewährt hatten, wurden sie im System der Meritokratie, der Auswahl nach Leistung, befördert. Als Arbeitskräfte wurden Strafgefangene eingesetzt. Denn Xinjiang war auch kaiserliche Strafkolonie. Und schon im vorletzten Jahrhundert siedelten sich Chinesen aus dem überbevölkerten Ostchina in Xinjiang an.
Nicht nur die chinesischen Kaiser, sondern auch die russischen Zaren wollten Xinjiang kontrollieren, mit wechselndem Erfolg. In den Jahrzehnten nach dem Zerfall des Kaiserreichs 1911 und nach dem Sieg der russischen Oktoberrevolution 1917 über das Zarenreich gehörte dieser Landesteil formal zur Republik China. In Xinjiang wie anderswo in Zentralasien entstanden zu der Zeit politische Bewegungen für nationale Unabhängigkeit. Sie propagierten die Unabhängigkeit Xinjiangs bzw. des vorwiegend von muslimischen Turkvölkern besiedelten Südwestens der Provinz. 1947 wurde mit Unterstützung der sowjetischen KPdSU die kommunistisch geführte Volksrepublik Ostturkestan gegründet. Die Volksbefreiungsarmee unter Mao war zu der Zeit gerade damit beschäftigt, die Bauern in Chinas Landgebieten und schließlich die großen Städte zu befreien. Nach Ausrufung der Volksrepublik China 1949 übernahm die chinesische Regierung auch die Kontrolle über die Grenzprovinzen Tibet und Xinjiang.
Als 40 Jahre später die Sowjetunion zerfiel und die an Xinjiang angrenzenden früheren Sowjetrepubliken ihre staatliche Unabhängigkeit erklärten und aus der Sowjetunion austraten, bekam der uigurische Separatismus einen ganz neuen Schub. Die Nachbarschaft Xinjiangs zu Afghanistan, wo US-gesponsorte Islamisten wenige Jahre zuvor die sowjetischen Besatzungstruppen vertrieben hatten, tat vermutlich ein Übriges. In Xinjiang begann eine Welle des separatistischen, islamistischen Terrors, der wohl erst durch die Repressionskampagne der chinesischen Regierung gestoppt werden konnte.
Ausbildung, Infrastruktur und Wachstum als Basis für EntwicklungGute Ausbildung, funktionierende Infrastruktur und wirtschaftliches Wachstum sind überall auf der Welt die elementaren Voraussetzungen für die gesellschaftliche Entwicklung. Aus Sicht der chinesischen Politik ist dies auch die Basis, um Extremismus und Separatismus erfolgreich zu bekämpfen.
Xinjiang hat viele Bodenschätze – darunter Öl und Gas und Polysilizium als Rohstoff für die Solarindustrie. Die Landwirtschaft bietet Erzeugnisse wie Wein, Obst, Milchprodukte aus dem Nordwesten oder Baumwolle. Ein Viertel der Weltproduktion von Baumwolle stammt aus dieser Region. Ihr Nachteil ist die riesige Entfernung von den wirtschaftlichen und industriellen Zentren: fast 4.000 km bis nach Shanghai, etwas weniger als die Entfernung vom Nordkap bis nach Sizilien. Aber die chinesische Regierung entwickelt Xinjiang jetzt als Brücke nach Eurasien und Europa. Damit wird aus der Randlage der Region ein Trumpf. Denn Xinjiang hat eine zentrale Rolle im geopolitischen Projekt der Neuen Seidenstraße (Belt and Road Initiative BRI). Das Wirtschaftswachstum in der Region betrug zuletzt 7%.
Schon seit Jahrtausenden wird Xinjiang von Karawanen von Ost nach West und umgekehrt durchquert. Die Ausstellungen in den Museen Xinjiangs belegen die wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung dieser alten Handelswege. Heute sind modernste Logistikzentren in Ürümqi für die Route über Kasachstan und im Süden bei Kashgar für den Weg über Tadschikistan entstanden. 2018 wurde der Binnenhafen Ürümqi International Land Port als Knotenpunkt der Neuen Seidenstraße gegründet. Die Neue Seidenstraße kann die geopolitische Rolle Chinas tiefgreifend verändern und für die gesamte eurasische Region neue. Wachstumschancen eröffnen.
Seit Gründung hat dieser «trockene Hafen» in Ürümqi Investitionen in Milliardenhöhe angezogen und sich zu einem Wirtschafts- und Verkehrszentrum mitten auf der zentralasiatischen Landmasse etabliert. China ist darüber mit mehr als 50 europäischen Städten und aufstrebenden Märkten in Zentralasien verbunden. Der Binnenhafen von Ürümqi ist heute eine multimodale Drehscheibe zwischen Schiene, Straße und Luft. Güterzüge verbinden China über Schienenkorridore durch Kasachstan, Russland, Polen und Deutschland.
In den neuen, staatlich finanzierten Industrieparks investieren vor allem Staats- und Privatkonzerne aus Ost- und Südchina. Der Eisenbahnkonzern CRCC baut hier riesige Maschinen zur Baumwollernte. Der staatliche Autokonzern GAC aus Guangzhou im Perlflussdelta hat in Ürümqi ein nagelneues Montagewerk für Elektroautos. Ein Privatunternehmen aus der Technologiemetropole Shenzhen produziert in der Nähe zur Grenze nach Kasachstan Batterien. Für alle Beschäftigten gleich welcher Ethnie gelten die gleichen Arbeitsbedingungen und die gleiche Bezahlung.
Westliche Investoren sind kaum vertreten, obwohl sich hier im äußersten Westen Chinas und in den angrenzenden Ländern neue Märkte entwickeln. Der VW-Konzern hat sein über 10 Jahre bestehendes Montagewerk in Ürümqi geschlossen - wohl auf Druck der USA und von westlichen regierungsfinanzierten NGOs. Ebenso BASF. Auch hinter der nagelneuen Textilmaschinenfabrik der schweizerischen Saurer-Gruppe in Ürümqi mit den Marken Saurer, Emag und Schlafhorst steckt kein westlicher Investor mehr, sondern ein privater Konzern aus Shanghai, die Jinsheng-Gruppe. Die hat schon vor Jahren diese Perlen des europäischen Maschinenbaus übernommen.
Weil Xinjiang dünn besiedelt ist und zudem ein ausgeprägt kontinentales Klima hat mit viel Sonne und Hitze im Sommer und Kälte im Winter, ist es ein idealer Standort für riesige Solarparks. Aus dem Flugzeug gewinnt man einen Eindruck, in welchem Tempo China den Ausbau der erneuerbaren Energien speziell in Westchina vorangetrieben hat.
Chinas Ethnien- und ReligionspolitikFindet in Xinjiang ein kultureller Genozid an den Uiguren statt? Sollen die Uiguren zwangsweise sinisiert werden? So die inzwischen veränderte westliche Propaganda gegen China, nachdem Horrorgeschichten über Völkermord oder Genozid an den Uiguren nicht belegt werden konnten und international zu wenig Echo fanden.
Auf unserer Reise durch Xinjiang gab es aber keine Hinweise für die Unterdrückung der uigurischen Kultur und der Traditionen und Bräuche. Die Freiheit, die Sprache der eigenen Ethnie oder Nationalität zu nutzen und weiterzuentwickeln, ist in der chinesischen Verfassung festgeschrieben. In Xinjiang erscheinen Zeitungen in insgesamt sechs verschiedenen Sprachen. Die offizielle Zeitung Xinjiang Daily erscheint täglich viersprachig. Verlage publizieren Zeitschriften und Bücher in sechs Sprachen.
Gleichzeitig ist Mandarin die universelle Sprache, die alle Staatsbürger Chinas beherrschen sollen. Bei zwei Besuchen in Kindergärten konnten wir erleben, wie die kleinen Kinder in Mandarin UND in der uigurischen Sprache unterrichtet werden. Auch das Lernmaterial ist mehrsprachig. Waren das Fake-Inszenierungen speziell für unsere internationale Gruppe? Wahrscheinlich nicht. Denn China versteht sich – so die Vorträge von chinesischen Professoren – als multi-ethnischer Staat, der kulturelle Diversität fördert. Das ist die offizielle Politik und nicht etwa die erzwungene Sinisierung der ca. 140 Mio. Staatsbürger, die keine Han-Chinesen sind, sondern Angehörige nationaler Minderheiten.
Eine Randbemerkung: Deutschland mit 25% Staatsbürgern und über 30% Einwohnern nicht-deutscher Abkunft könnte vielleicht von China lernen und die Propaganda von der bio-deutschen, christlich geprägten Leitkultur endlich beerdigen.
Dass China die Bedeutung des Mandarin als universelle Sprache des Landes betont, liegt an den Bemühungen um die Integration der Uiguren und der anderen Ethnien in die Gesellschaft. Eine Ausbildung auf einer einheitlichen sprachlichen Grundlage fördert den gesellschaftlichen Zusammenhalt und eröffnet Arbeits- und Studienperspektiven im ganzen Land. Es gebe in China keine erzwungene Integration der verschiedenen Ethnien, Ziel sei die natürliche Integration und die Inklusion aller Ethnien.
Allerdings wird die Turk-Sprache Uigurisch an den Schulen nur bis zur Unteren Mittelschule unterrichtet, wie in allen Regionen ethnischer Minderheiten. Das kann man kritisieren. Auch chinesische Studien zeigen, dass in Han-Schulen in Ürümqi teilweise schon das Sprechen der uigurischen Sprache sanktioniert wird. Der Sinologe Heberer zitiert zahlreiche Berichte chinesischer Wissenschaftler, die diskriminierendes Verhalten von han-chinesischen Funktionären gegenüber Uiguren festgestellt haben. (2)
Zur Kulturpolitik in Xinjiang gehören aber auch über 100 öffentliche Bibliotheken, 60 Museen und 50 Kunstgalerien. Im vorwiegend uigurisch geprägten Kashgar gibt es ein modernes Science Museum über vier Ebenen, das in der Qualität mit dem Deutschen Museum in München vergleichbar ist und das auch neueste Entwicklungen wie KI und Robotik verständlich und erlebbar macht.
In China gilt Religionsfreiheit. Jede/r kann nach seiner Facon selig werden. Moscheen oder buddhistische oder taoistische Tempel oder christliche Kirchen werden von vielen Gläubigen besucht, wie jeder China-Reisende sehen kann. Für Chinas Religionspolitik gilt aber gleichzeitig die Devise, die staatliche Einheit zu sichern und deshalb jede Einmischung von außen zu unterbinden. Das gilt für den Vatikan ebenso wie für fundamentalistische US-Evangelikale, für muslimische Religionskrieger oder für den Dalai Lama.
Die Trennung von Religion und Staat wird strikt vollzogen. Das hindert die chinesischen Staatsorgane aber nicht daran, die Renovierung oder den Neubau von Kirchen, Moscheen und Tempeln zu finanzieren. So hat die Provinzregierung in Ürümqi ein nagelneues Muslim-Institut mit angeschlossenem Internat gebaut, an dem auch künftige Imame ausgebildet werden. Natürlich sollen gläubige Muslime damit auch auf den chinesischen Staat festgelegt werden. Aber das ist allemal besser als etwa die in Deutschland praktizierte Ausgrenzung der islamischen Religionsstätten in triste Gewerbegebiete –bei gleichzeitiger Klage darüber, man wisse nicht, ob da vielleicht Salafisten ausgebildet würden.
Ob –wie im Westen behauptet – im Rahmen der Repression der vergangenen Jahre gegen den islamistischen Terror Moscheen im großen Maßstab planvoll zerstört worden sind, ließ sich nicht in Erfahrung bringen. Aber es ist nicht wahrscheinlich.
Separatismus und Terrorismus und staatliche Repression in XinjiangEine große Ausstellung in Ürümqi informiert über den Terrorismus und Separatismus in der Provinz und in ganz China. Das Ausmaß des Terrors, den islamistische uigurische Terroristen von 1990 bis 2016 begangen haben, ist im Westen unbekannt. Ich selbst wusste nur von einem Pogrom 2009 in Ürümqi, als uigurische Terroristen mehr als 200 Han-Chinesen töteten und Geschäfte und ganze Straßenzüge abfackelten. Jahre später fuhren uigurische Terroristen auf dem Tiananmen-Platz in Peking mit einem LKW in eine Menschenmenge und töteten dutzende, meistens Touristen. Uigurische Terroristen veranstalteten 2014 auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs Kunming, etwa 3000 km von Urumqi entfernt, mit Macheten ein Massaker mit über 30 Toten. Die USA hatten die verantwortliche Organisation hinter den Massakern, die East Turkestan Islamic Movement ETIM, schon 2002 als terroristische Organisation eingestuft. Aber 2020, noch in der ersten Präsidentschaft von Trump, wurde diese Klassifizierung aufgehoben.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass das CIA-Pentagon-Terrorismus-Franchise im benachbarten Afghanistan im Zusammenspiel mit uigurischen Islamisten eine perfekte Kampagne zur Destabilisierung der Region inszeniert hat.
Spätestens nach dem Massaker 2009 in Ürümqi gab es viele Stimmen vor allem in den sozialen Medien in China, die das Versagen der Regierung kritisierten. Sie hätte die Bürger nicht geschützt, außerdem werde in die Gebiete der ethnischen Minderheiten zu viel Geld gesteckt. Besonders die Uiguren und die Tibeter seien undankbar. Im tibetischen Lhasa hatte es nämlich 2008, punktgenau zur Olympiade in Peking, ein Pogrom gegen Han-Chinesen mit dutzenden Toten gegeben. Ein Schelm, wer dabei an ausländische Einflussnahme denkt!
Nach den Terroranschlägen in Xinjiang wurden in anderen Provinzen Lokalbehörden auf eigene Faust aktiv und stoppten mit der lokalen Polizei Züge mit Arbeitsmigranten aus Xinjiang. Die Züge sollten eigentlich in die Industriegebiete an der Ostküste fahren, mussten aber umkehren. Nach Berichten aus dem Perlflussdelta, dem Herz der “Fabrik der Welt", weigerten sich Unternehmer, Uiguren zu beschäftigen. Das sei ein Sicherheitsrisiko, außerdem könnten sie nicht gut arbeiten.
Gegen diesen Terror, der nicht nur die Sicherheit in Xinjiang bedrohte, sondern die Stabilität und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in ganz China in Frage stellte, legte die chinesische Zentralregierung ein massives Repressionsprogramm auf. Es zielte vor allem auf Uiguren. Dabei wurden zeitweilig auch persönliche Freiheitsrechte außer Kraft gesetzt, wie chinesische Behördenvertreter gegenüber einer Delegation deutscher China-Wissenschaftler offen zugegeben haben. (3) Es kann als sicher gelten, dass Uiguren zeitweilig in Arbeitslager kamen zur Umschulung und politischen Bildung. Aber die in den deutschen Medien ständig wiederholte Zahl von zeitweilig 1-2 Mio. Uiguren in Arbeitslagern erscheint absurd. Das hätte bei ca. 10 Mio. Uiguren insgesamt – inklusive Kleinkindern und Alten – bedeutet, dass alle uigurischen Männer im besten Alter zwischen 16 und 40 weggesperrt waren. Das ist nicht glaubhaft.
Inzwischen hat die chinesische Regierung die gesellschaftliche und politische Situation in Xinjiang offensichtlich erfolgreich stabilisiert. Das hat auch unsere Reise gezeigt. Ob der politische Preis dafür zu hoch war, ist schwer zu beurteilen. An der Reise teilnehmende türkische Journalisten berichteten von keinen Problemen, auf der Straße und privat mit Uiguren ins Gespräch zu kommen. Uigurisch ist eine Turksprache. Nur manchmal habe es Unsicherheiten gegeben.
Nachwort: Kognitive Kriegsführung des Westens gegen ChinaNach der Reise lässt sich feststellen, dass das Ausmaß der westlichen Desinformation über Xinjiang auch die Vorstellungen eines kritischen Medienkonsumenten sprengt. Die Wahrheit über den Terror und die Repression in Xinjiang liegt nicht in der Mitte, sondern ziemlich auf der Seite Chinas. Leider konnte China seine eigene Darstellung im Westen offensichtlich nicht rüberbringen.
Dagegen waren Journalisten und Medienvertreter aus dem sog. Globalen Süden mit einer ganz anderen Sicht auf die Ereignisse nach Xinjiang gekommen.
In einem Vortrag mit der Überschrift “Cognitive warfare or journalistic practice information. Manipulation by some countries” befasste sich Prof. ZHENG Liang von der Jinan University mit der westlichen Berichterstattung über Xinjiang speziell und über China im Allgemeinen.
Ein paar Highlights aus seinem Vortrag:
- In den Fotosammlungen im Netz und in Printmedien von angeblich eingekerkerten Uiguren sind auch Bilder von Schauspielern aus Hongkong.
- In der BBC-TV-Berichterstattung über China und Xinjiang erscheint China immer im Grauschleier, auch wenn chinesische Bilder vom selben Ort und zur selben Zeit blauen Himmel zeigen.
- Die zeitweilige FBI-Mitarbeiterin Sibel Edmonds berichtete auf der Plattform X, dass die USA zwischen 1996 und 2002 jede einzelne terroristische Aktion in Xinjiang geplant, finanziert und bei der Ausführung unterstützt haben.
-----------------
Fußnoten
(1) Philipp Mattheis: “Ein Volk verschwindet. China und die Uiguren”, Berlin 2022
(2) Thomas Heberer: “Sicherheitsdilemma und Nationsbildung: Politisch-gesellschaftliche Hintergründe der Entwicklung in Xinjiang’, in: siehe Fußnote 3
(3) Gesk, Heberer, Paech, Schaedler, Schmidt-Glintzer: “Xinjiang – eine Region im Spannungsfeld von Geschichte und Moderne. Beiträge zu einer Debatte”, Münster 2024
Die Ostseeregion – tausend Jahre Kriege ohne Ende
Die Ostseeregion war in der Vergangenheit bis in das 20. Jahrhundert hinein ständiger Schauplatz erbitterter Konflikte und Kriege zwischen den Völkern. Nun droht sie erneut zum Kriegsschauplatz zu werden. Und Russland steht wieder als Feind auf der Tagesordnung.
Dabei in vorderster Reihe die baltischen Staaten. Für den estnischen EU-Abgeordneten Riho Terras, Mitglied der Fraktion der EVP (Christdemokraten) und ehemaliger Generalstabschef seines Landes, stellt die russische Bedrohung ein historisches Muster dar: „Ein russischer Angriff ist jederzeit möglich. Da sind wir nicht blauäugig. In den letzten tausend Jahren wurden wir 42-mal von Russland angegriffen – im Schnitt alle 25 Jahre“ (Terras, 2025).
Hier wird Geschichte instrumentalisiert und gerät zu mythenbildender Geschichtspolitik mit polemisch zugespitzter Zahlenspielerei für die Feindbildproduktion, zumal es vor tausend Jahren auch noch gar keinen Staat Estland gab. Allerdings sind Mythen- und Symbolbildung in unterschiedlichen Formen und Farben keinem Staat und keiner Gesellschaft fremd. So dient auch im nahen Russland seit 2005 die Befreiung Moskaus von polnischen Truppen und das Ende polnischer Besatzung im Jahre 1612 wieder als ein nationales Symbol. Daran wird mit einem Gedenktag am 4. November erinnert. Nach der Oktoberrevolution war er gestrichen worden.
Vor diesem Hintergrund soll ein Blick auf die wechselvolle Geschichte in der Ostseeregion und des Baltikums geworfen werden. Eingangs werden einige wichtige Entwicklungslinien und die Bedeutung des Kriegsschauplatzes Baltikum kurz vorgestellt. Dem schließen sich Stationen des Aufstiegs Russlands zur Großmacht an Ostsee und in Europa an, wobei der I. und II. Weltkrieg nicht behandelt werden. Mit Ausnahme eines kurzen, wenig bekannten Krieges zwischen beiden Kriegen, dessen Auswertung für die Kriegführung Deutschlands im I. Weltkrieg entscheidend war.
Das Hochmittelalter – Beginn von Ostexpansion, Kreuzzügen, Konflikten und pausenlosen KriegenDer Beginn dieser Entwicklungen ist eng mit dem Entstehen (ständischer) Nationen verbunden, die durch das Scheitern der universalistischen Mächte Kaiser und Papst entstanden waren und in Konkurrenz gerieten. Wichtig für Kriege dazu der große religiöse Bruch im Jahre 1054 zwischen dem lateinisch-römischen und griechisch-orthodoxem Glaubens- und Lebensraum und die sich allmählich abzeichnenden Auseinandersetzungen zwischen Protestantismus und Katholizismus. So wurde die von vielen Völkerschaften umgebene Ostsee zu einer von Macht- und Herrschaftsinteressen durchdrungenen Region, stets auf der Suche nach Machtausbau, Landgewinn, ausbeutbaren Agrar- und Waldflächen, künftigen Geldquellen und lukrativen Handelsgeschäften unter Einsatz aller dafür notwendigen Mittel und Methoden. Und im Zuge der Ostexpansion richtete sich der Blick immer wieder auch auf Russland mit seiner gewaltigen Landfläche, den enormen Ressourcen und begehrten Handelswaren. Und für Russland rückte der Kampf um den freien Zugang seines Handels zur Ostsee und für seine wirtschaftliche Entwicklung mehr und mehr in den Mittelpunkt.
Das große Ringen um Macht und Herrschaft in der OstseeregionÜber Jahrhunderte wurde hier um Macht und Herrschaft untereinander und gegeneinander zwischen Dänemark, Schweden, Deutschland und Polen (Polen-Litauen) und Russland gerungen:
- Der Deutsche Orden, militärisch straff organisiert, eroberte an der Ostseeküste große Gebiete. Das Kolonialreich bestand von 1230 bis 1561 und umfasste in etwa das Gebiet des späteren West- und Ostpreußens und im Baltikum das des heutigen Estland und Lettland (damals Livland genannt). Der Deutsche Ordensstaat wie auch die Ostkolonisation insgesamt begünstigten den Aufstieg der Deutschen Hanse.
- Die Deutsche Hanse beherrschte den Ostseehandel über zwei Jahrhunderte und schloss russische wie andere Kaufleute in dieser Zeit fast völlig vom Handel aus. Nach Blütezeit und beginnendem Abstieg der Hanse wurde der russische („moskowitische“) Außenhandel zunehmend von holländischen und englischen Kaufleuten bis in das 17. Jahrhundert hinein beherrscht. Russland sollte weiter daran gehindert werden, zu einer militärischen und wirtschaftlichen Großmacht aufzusteigen.
- Schweden, Litauen und Polen konnten sich gegenüber Ordensstaat und Ostkolonisation behaupten und selbst nach Finnland bzw. in das von der Mongoleninvasion geschwächte Russland (genauer die „Rus“) hinein expandieren, erleichtert zudem dadurch, dass es politisch schon länger zersplittert war in häufig untereinander verfeindete Fürstentümer. Polen konnte sich zwar gegenüber dem Deutschen Orden behaupten, wurde durch ihn aber für 157 Jahre von der Teilnahme am Ostseehandel bis zum 2. Frieden von Thorn im Jahre 1466 ausgeschlossen.
- Schweden wurde nach Verlassen der konfliktreichen Kalmarer Union (1523) mit Dänemark zum erfolgreichen Rivalen Dänemarks im Kampf um die Ostseeherrschaft, dem Dominium maris baltici. Dänemarks dominierende Rolle in der Ostseeregion ging mit dem Frieden von Roskilde (1658) zu Ende. Es beherrschte lange den Zugang zur Ostsee, den Sund. Der Sundzoll bildete die wichtigste Einnahmequelle der Monarchie. Ungeachtet der Kriege und Konflikte mit Russland blieb Polen wichtigster Gegner Schwedens. Ursächlich bedingt durch verwandtschaftliche und dynastische Verflechtungen folgte daraus eine nur durch zeitlich befristete Waffenstillstände unterbrochenen Ära polnisch-schwedischer Kriege, die insgesamt bis 1660 andauern sollte.
- Das Unionskönigreich Polen-Litauen wurde während des 15. Und 16. Jahrhunderts zum mächtigsten politischen Gebilde des östlichen Europas und reichte von der Ostsee bis weit in die heutige Ukraine hinein. Zu dieser einzigartigen Machtstellung verhalfen Siege gegen den Deutschen Orden und die Schwäche russischer Fürstentümer.
Besonderen Zündstoff für Kriege bildete das Baltikum. Es war mit seinen Häfen und Handelsplätzen sowie der nahen Einmündung der Newa in die Ostsee von strategischer Bedeutung für den Handel nach Westen wie nach Osten mit seinen Zugängen zu nahen russischen Handelszentren (Nowgorod, Pskow) und weiter über Wasserwege und den Dnjepr, das Schwarze Meer bis Byzanz und zur Seidenstraße. Es wurde zum Kriegs- und Aufmarschgebiet für den Deutschen Orden, für Schweden, Polen und Russland. Und die Herrschaft über das Baltikum bildete in der frühen Neuzeit den Schlüssel für das Dominium maris baltici. Vom Baltikum aus starteten die Invasionen Schwedens und des Deutschen Ordens nach Russland. Doch sie scheiterten 1240 an der Newa-Mündung und auf dem Eis des Peipussees 1240. Beide wollten die strategische und wirtschaftliche Kontrolle über den lukrativen Ostseehandel Russlands und dessen Zugang zur Ostsee haben. Schwedens Expansionspolitik ab 1560 und richtete sich erneut nach Osten und beginnt im Baltikum. Wesentlich dafür sind starke wirtschaftliche und fiskalische Interessen am Russlandhandel. Später setzte Schweden – inzwischen zur regionalen Großmacht aufgestiegen – alles daran, Russlands wirtschaftliche und militärische Entwicklung zu behindern. So blockierte es den Zugang Russlands zur Ostsee für fast hundert Jahre von 1617 an bis zu dessen Sieg im Großen Nordischen Krieg im Jahre 1721.
Zwischen 1492 und 1582 führten Moskau und Polen-Litauen bzw. das bis 1561 unter Deutscher Ordensherrschaft stehende Livland insgesamt sechs Kriege gegeneinander. Während der Hälfte dieser Zeit herrschte Krieg, der wechselseitig erbarmungslos geführt wurde. Dementsprechend gestaltete sich jeweils die Wahrnehmung des Feindes. Das im Westen des Kontinents verbreitete Bild vom „asiatischen, barbarischen Russland“ ist in dieser Zeit grundgelegt und entstand an der katholischen Universität Krakau.
Druck erzeugt Gegendruck: Russlands Kriege um Zugang zur OstseeDie jahrhundertelang währenden Behinderungen russischen Handels bis hin zur Blockade des Zugangs zur Ostsee wurden für Russland ein zum Kriege treibendes Motiv. Entscheidend war, endlich an der Ostsee eine Basis für einen unabhängigen Außenhandel zu gewinnen und mit den Einnahmen die wirtschaftliche Modernisierung des Landes und des Militärwesens voranzutreiben. Ab Ende des 15. Jahrhunderts begann deshalb eine ganze Serie von Kriegen unter Iwan III. und Iwan IV. und ihren Nachfolgern für den freien Zugang zur Ostsee. Die Auseinandersetzungen mit Schweden und Polen im Baltikum endeten aber allesamt in Niederlagen.
Erst mit dem Großen Nordischen Krieg von 1700 bis 1720 wendete sich das Blatt. Ein Bündnis bildete sich mit Russland, Polen und Dänemark gegen Schweden. Sie hatten allesamt unter der Expansion Schwedens gelitten. Nach anfänglicher Niederlage des Bündnisses rüstete Russland dann in kurzer Zeit massiv auf und konnte König Karl XII. vernichtend 1709 in der Schlacht von Poltawa schlagen. Der lange Krieg endete zwischen Russland und Schweden mit dem Frieden von Nystad 1721. Schwedens Rolle als Großmacht war gebrochen. Schwedisch-Ingermanland, Estland, Lettland sowie Südkarelien gehörten nun zu Russland. Der Zugang zur Ostsee war dauerhaft gesichert. Russland stieg durch diesen Sieg endgültig zum beherrschenden Akteur in der Ostseeregion auf, gehörte nun zum Kreis der europäischen Großmächte und bestimmte deren Politik zunehmend mit. Gleichzeitig wurde die Ostsee ab dann durch den britisch-russischen Gegensatz beherrscht. Englands Interesse richtete sich darauf, ein Übergewicht Russlands im Ostseehandel zu verhindern.
Napoleons Russlandfeldzug 1812 endet in einer KatastropheDie Ergebnisse der Französischen Revolution von 1789 gerieten immer mehr unter Druck der konservativen Großmächte Österreich, Preußen, Russland und England. Frankreich unter Napoleon Bonaparte nahm deshalb seine frühere Expansionspolitik wieder auf. Der größte Gegner blieb England. Frankreich beherrschte zwar – militärisch hochgerüstet – den Kontinent, konnte aber die englische Vorherrschaft auf See nicht brechen.
Deshalb versuchte Napoleon Bonaparte das Ziel an Land mit einer „Kontinentalsperre“, einer Wirtschaftsblockade, zu erreichen. Doch Zar Alexander I. wollte weder dem Hegemonieanspruch Napoleons folgen noch den Abbruch des Handels mit seinem inzwischen wichtigsten Partner England riskieren. Schwedische Besitz- und Handelsinteressen standen ebenfalls dagegen und Russland wurde sogar militärische Hilfe in Aussicht gestellt. Napoleon versuchte den Zaren deshalb mit einem Feldzug 1812 zum Nachgeben zu zwingen. Seine weit überlegene Armee kam zwar bis Moskau, konnte aber Russland nicht besiegen und der Feldzug endete in einer Katastrophe. Unter den Soldaten aus ganz Europa waren auch über
70 000 Polen. Sie setzten ihre Hoffnungen auf vage und hinhaltende Versprechungen Napoleons zur Wiederherstellung des Staates Polen („Rzeczpospolita“) nach einem Sieg über Russland. Denn Polens Staatlichkeit war durch Russland, Österreich und Preußen mit drei Teilungen in den Jahren 1772, 1793 und 1795 beendet worden. Der einst mächtige Doppelstaat Polen-Litauen war von der Landkarte Europas für 123 Jahre bis 1918 verschwunden und hatte der „polnischen Frage“ Platz gemacht.
Polens Krieg für alte Größe mit der Sowjetunion (1920 – 1921) – Siegfrieden, Lehren und FolgenNach dem Ende des I. Weltkrieges entstand der Staat Polen aus den Trümmern dreier Kaiserreiche. Staatschef Pilsudski akzeptierte die provisorisch festgelegte Curzon-Linie als polnische Ostgrenze nicht. Polen sollte wieder die Größe wie bis 1772 haben und damit wie vor den Teilungen. Das führte zum Krieg mit der Sowjetunion, der 1921 mit dem Frieden von Riga beendet wurde. Er war mit deutlichen Nachteilen für die Sowjetunion verbunden und wurde unter der Bedingung geschlossen, dass sie auf die von Polen beanspruchten Ostgebiete jenseits der Curzon-Linie verzichtete. Mit dem Hitler-Stalin-Pakt wurde die Curzon-Linie als Grenzverlauf wieder festgeschrieben.
Von großer militärischer Bedeutung für die Kriegführung waren die Lehren aus diesem Krieg, der in Militärakademien in Ost wie in West genau studiert wurde. Er wurde als letzte Reiterschlacht geführt, also mit wenigen Waffen, aber äußerst beweglichen Verbänden.
Deutlich wurde, dass Panzer als neues Waffensystem genau dieselbe Art von mobilen Fähigkeiten wie Reiterverbände hatten. Der sowjetische Marschall Tuchatschewski erkannte das als einer der ersten in aller Klarheit. Er begann, Rüstung und Strategie der Roten Armee für die Zukunft auf diese Fähigkeiten hin auszurichten. Er konnte aber seine Arbeiten nicht fortsetzen, da er dem Terror Stalins zum Opfer fiel. Deshalb war Deutschlands Blitzkriegsstrategie anfangs des Russlandfeldzuges mit schnellen, tiefen Vorstößen von Panzerverbänden in Verbindung mit Luftunterstützung so erfolgreich. Entscheidend an der Strategieentwicklung war Panzergeneral Guderian beteiligt, der die damalige Kriegführung genau studiert hatte. Möglicherweise hätte der Krieg gegen die Sowjetunion schon zu Beginn eine andere Wendung nehmen und vielleicht ein kurzer sein können.
Nach Ende der Blockkonfrontation weiter mit Konflikt und GewaltDie Ostseeregion droht erneut zum Kriegsschauplatz zu werden. Die wachsende Militarisierung der gesamten Region kündet davon. Vergessen wird, wie schwer Ostsee und große Teile angrenzender Länder durch beide Weltkriege gelitten haben. Man richtet auch nicht mehr den Blick auf die Schrecken des I. und II. Weltkrieges mit insgesamt fast fünfundsiebzig Millionen Toten, dazu Millionen Verletzten und Vertriebenen, zerstörten Städten, Fabriken und Landschaften. Vergessen, dass das Deutsche Kaiserreich entscheidend zum Kriegsausbruch 1914 beigetragen hat. Verdrängt, dass der Nationalsozialismus mit dem Ostfeldzug im II. Weltkrieg auf die Auslöschung der „slawischen Untermenschen“ zielte – die genozidale Züge aufweisende Leningrad-Blockade war Teil der Strategie – und auf Gewinnung „neuen Lebensraums“ und dessen Ressourcen. Bewusst abgehakt die Erfahrungen und Erkenntnisse nach Ende des II. Weltkrieges aus dem waffenstarrenden Kalten Krieg mit Schritten zu Abrüstung, Entspannung und gemeinsamer Sicherheit. Sie sind nach dem Ende der Blockkonfrontation nicht genutzt und weiterentwickelt worden. Mit der NATO- Osterweiterung seit den 1990er Jahren wurde das legitime Sicherheitsinteresse Russlands übergangen und der lange Weg zu dessen Krieg mit der Ukraine, zu Eskalation statt Entspannung beschritten (Verheugen, Erler, 2024). Das alte Feindbild Russland ist wieder voll entflammt. Und Geschichte wiederholt sich in neuen Formen: jahrzehntelange Zusammenarbeit zur Versorgung mit Öl und Gas ist beendet, ein Pipelinestrang Nordstream- Pipeline durch Sabotage zerstört, umfassende Sanktionspakete zur Strangulierung russischer Wirtschaft sind auf den Weg gebracht. Inzwischen wachsen Kriegsgefahren durch immense Aufrüstungen, fehlende Abrüstungsschritte und die bereits vor Jahren begangenen, einseitigen Kündigungen des ABM- und INF-Vertrages seitens der USA. Der alte Kampf für Frieden, Abrüstung, Zusammenarbeit und Völkerverständigung bleibt weiter auf der Tagesordnung.
-----------
Literatur:
Alexander, Manfred: Kleine Geschichte Polens, Reclam Verlag, Stuttgart 2003; Gitermann, Valentin: Geschichte Russlands Bd 1-3, Europäische Verlagsanstalt, Hamburg 1949;
Hofbauer, Hannes: Feindbild Russland – Geschichte einer Dämonisierung, Promedia Verlag, Wien 2016;
Komlosy, Andrea; Nolte, Hans-Heinrich, Sooman, Imbi (Hg.) Ostsee 700 – 2000. Gesellschaft-Wirtschaft-Kultur, Promedia Verlag, Wien 2008;
Lehnstaedt, Stephan: Der vergessene Sieg. Der Polnisch-Sowjetische Krieg 1919 – 1921 und die Entstehung des modernen Osteuropa, Beck Verlag, München 2019;
Luhmann, Jochen: unveröffentlichter Entwurf für eine Buchbesprechung zu Stephan
Lehnstaedts Buch „Der vergessene Sieg….“, 2020);
Nolte, Hans-Heinrich: Geschichte Russlands, Reclam Verlag, Stuttgart 2024;
Schildhauer, Johannes; Fritze, Konrad; Stark, Walter: Die Hanse, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1981;
Terras, Riho: „Wenn die Russen kommen, schiesst in Estland jeder Baum“, Interview mit Lara Lattek, aktualisiert am 17.6.2025, in: https://www.gmx.ch/magazine/politik/russland- krieg-ukraine/riho-terras-russen-schiesst-estland-baum-41083006; Abruf: 23.6.2025; Topolski, Jerzy: Die Geschichte Polens, Verlag Interpress, Warszawa 1985;
Verheugen, Günter; Erler, Petra: Der lange Weg zum Krieg, Wilhelm Heyne Verlag München 2024.
---------------------------
Detlef Bimboes ist Mitglied im Gesprächskreis Frieden und Sicherheitspolitik der Rosa Luxemburg Stiftung in Berlin
Nord Stream | Verborgener Kontext des Ukraine-Kriegs – Fabian Scheidler
Wir steigen von YouTube aus. Treten Sie unseren neuen Kanälen bei. Klicken Sie auf die untenstehenden Links und abonnieren Sie noch heute: ► RUMBLE► TELEGRAM In dieser Folge von Die Quelle spricht unser leitender Redakteur Zain Raza mit dem Autor und unabhängigen Journalisten Fabian Scheidler über die neuesten Entwicklungen im Rätsel um die Sprengung der Nord Stream-Pipeline – […]
Der Beitrag Nord Stream | Verborgener Kontext des Ukraine-Kriegs – Fabian Scheidler erschien zuerst auf acTVism.
Baden-Württembergs bizarrer Bau-Turbo für die Bundeswehr
Das Ende der Konversion
Dimitri verhaftet in Jordanien / Trump droht Netanjahu
In diesem Video, das exklusiv auf Deutsch auf unserem Kanal veröffentlicht wurde, berichtet der investigative Journalist und Menschenrechtsanwalt Dimitri Lascaris aus Amman, Jordanien, wo er nach Dreharbeiten in der Nähe der israelischen Botschaft festgenommen wurde. Er schildert die Umstände seiner Verhaftung und geht der Frage nach, warum sie gerade in diesem Kontext stattfand. Darüber hinaus […]
Der Beitrag Dimitri verhaftet in Jordanien / Trump droht Netanjahu erschien zuerst auf acTVism.
Kampagne kritisiert geheime Pläne der Bundesregierung: "Kauf von Tomahawk-Marschflugkörpern birgt enormes Eskalations-potenzial!"
Israel hat der Welt „moralischen Schaden“ zugefügt mit Susan Abulhawa
Die Wissenschaftlerin, Autorin und Aktivistin Susan Abulhawa diskutiert mit Dimitri Lascaris über die Zukunft des palästinensischen Konflikts, das Recht der Palästinenser auf Widerstand, Donald Trumps jüngste Drohung, Palästinenser zu töten, Israels am wenigsten diskutierte Verbrechen und den „moralischen Schaden”, den Israel der Welt zugefügt hat. Dieses Video wurde von Reason2Resist produziert und am 20. Oktober […]
Der Beitrag Israel hat der Welt „moralischen Schaden“ zugefügt mit Susan Abulhawa erschien zuerst auf acTVism.
Offener Brief an Maria Corina Machado – von Nobel zu Nobel
Was bedeutet Frieden eigentlich?
EU „pausiert“ ihre wirkungslosen Sanktionen gegen Israel
Während Berichte über Hunger und anhaltende Angriffe Israels auf die Zivilbevölkerung in Gaza zunehmen, erklärte EU-Außenpolitikerin Kaja Kallas, dass die Europäische Union ihre ohnehin begrenzten Sanktionen gegen Israel vorerst ausgesetzt habe. In diesem Beitrag erläutert Dimitri Lascaris Israels wiederholte Verstöße gegen das Waffenstillstandsabkommen und stellt die Frage, ob diese Entscheidung der EU einen neuen Tiefpunkt […]
Der Beitrag EU „pausiert“ ihre wirkungslosen Sanktionen gegen Israel erschien zuerst auf acTVism.
Die geheime Geschichte der Israel-USA-Beziehung
In dieser Folge von Die Quelle spricht unser leitender Redakteur Zain Raza mit Scott Horton, Direktor des Libertarian Institute und renommierter Autor, über die neuesten Entwicklungen in der Ukraine und im Gazastreifen. Die Diskussion nimmt dann eine tiefere historische Wendung, untersucht die Beziehungen zwischen den USA und Israel und fragt, ob die jahrzehntelange Unterstützung Israels […]
Der Beitrag Die geheime Geschichte der Israel-USA-Beziehung erschien zuerst auf acTVism.
Ich wollte nach Palästina reisen – dann passierte DAS
In diesem Video berichtet der investigative Journalist und Menschenrechtsanwalt Dimitri Lascaris von seinem Versuch, im Oktober 2025 von Jordanien nach Palästina zu reisen. Was er dabei an der israelischen Grenze erlebte, hat ihn tief erschüttert. Er erzählt von den Sicherheitskontrollen an der Allenby Bridge, der Behandlung der Palästinenser – und warum diese Erfahrung seinen Blick […]
Der Beitrag Ich wollte nach Palästina reisen – dann passierte DAS erschien zuerst auf acTVism.
Die reichsten Deutschen – wie sich Macht und Vermögen verteilen
Zur gleichen Zeit, in der die CDU/CSU-SPD-Koalition neue Scheußlichkeiten ausbrütet, um Bürgergeldbezieher noch mehr zu kujonieren, ihnen damit drohen, bei Terminversäumnissen das Bürgergeld um 30% bis zu 100 % zu kürzen, ja selbst die Wohnungskosten nicht mehr zu übernehmen (aber damit wird, laut Merz, "niemand in die Obdachlosigkeit getrieben"), veröffentlicht das Manager Magazin sein alljährliches Sonderheft über den Reichtum in Deutschland: "Die 500 Reichsten Deutschen. Wie sich Macht und Vermögen verteilen."
Scheinbar kritisch (aber durchaus richtig!) schreibt die Redaktion über ihre Reichenliste: "Noch nie war sie so notwendig wie heute. Denn Vermögen bedeutet Macht." Und über die Verteilung von Vermögen und Macht soll mit der Veröffentlichung Transparenz hergestellt werden. Ja, selbst Thomas Piketty ("Das Kapital im 21. Jahrhundert") wird zitiert, der die Debatte um die wachsende Ungleichheit in westlichen Gesellschaften enorm beschleunigt habe.
Festgestellt wird: "Obwohl die deutsche Wirtschaft seit drei Jahren stagniert, gibt es hierzulande… immer mehr Milliardäre" – ihre Zahl stieg von 226 auf 256. Sieht man sich nur die hundert Reichsten an, so hat sich ihr Vermögen seit 2001 (dem ersten Jahr der Reichenliste) von 263 Mrd. Euro auf 758 Mrd. Euro in 2025 fast verdreifacht; das Bruttoinlandsprodukt hat sich im selben Zeitraum "nur" verdoppelt. Damit stieg der Anteil der Top 100 am BIP von 12% auf 17,7%. Und auch seit dem letzten Jahr, mit einer Wirtschaft in der Rezession, ging es "für die meisten der Top 500 auch im vergangenen Jahr vermögensmäßig bergauf" – erfreulich, nicht wahr?
Aber auch eine beunruhigende Frage wird aufgeworfen: "Werden Milliardäre bald höher besteuert?" – "Nicht auszuschließen", lautet die Antwort. Aber gemach: Zwar plädiere die Regierungspartei SPD in ihrem Wahlprogramm dafür, jedoch: "Mit dem Koalitionspartner CDU/CSU dürfte das allerdings kaum umsetzbar sein." Wohl wahr: Wenn es dafür nicht eine breite gesellschaftliche Bewegung unter Einschluss der Gewerkschaften gibt, müssen sich die Superreichen auch in den kommenden Jahren keine Sorgen machen.
Einige Einzelheiten: Der reichste Deutsche ist, wie schon im letzten Jahr, Dieter Schwarz, der sein Geld mit Einzelhandel (Lidl, Kaufland), Entsorgung, IT und Immobilien "verdient", mit 46,5 Mrd. Euro; verdienstvoll vom Manager Magazin ist es, dass bei allen Reichen die Quellen ihrer Vermögen aufgeführt werden. So werden bei den mit 36,5 Mrd. Zweitplatzierten, den Familien Susanne Klatten und Stefan Quandt, nicht nur BMW, sondern auch ihre Beteiligungen an sehr unterschiedlichen Firmen aufgeführt. Die Familie Porsche findet sich nach einem herben Rückgang von knapp 4 Mrd. Euro im Vergleich zum Vorjahr mit 15,5 Mrd. Euro auf Platz 12, die Schäfflers wiederum (Autozulieferer, Maschinenbau), die einen großangelegten Arbeitsplatzabbau durchführen, rückten mit einem Zuwachs von 2,5 Mrd. auf 10,1 Mrd. Euro um einige Plätze nach oben, auf Platz 21. Auch Medienunternehmer wie Mohn (Bertelsmann, Platz 29 mit 7,2 Mrd. Euro Euro), Familie Holtzbrinck (3,3 Mrd., Platz 79), Friede Springer und Mathias Döpfner (Springer Verlag, 2,9 Mrd. Euro und Platz 94) finden sich unter den Milliardären.
"In Deutschland stieg 2024 das Gesamtvermögen der Superreichen um 26,8 Milliarden US-Dollar auf inzwischen 625,4 Milliarden US-Dollar. Neun Milliardäre kamen hinzu, insgesamt seien es jetzt 130. Deutschland (83,5 Mio. Einwohner) hat damit nach den USA (345 Mio. Einwohner), China (1.437 Mrd. Einwohner) und Indien (1.417 Mrd. Einwohner) die meisten Milliardäre." (Oxfam "Bericht "Takers not Makers", 20.1.2025)
Das Magazin stellt fest: "Lange Jahre schien es, als sei Deutschland ein Land des alten Geldes – im Gegensatz etwa zu den USA." Doch seit 2001 tauchen auch Tech-Milliardäre auf wie etwa Dietmar Hopp (Platz 11 mit 15,8 Mrd. Euro) und Hasso Plattner (Platz 9 mit 17,7 Mrd Euro), beide SAP-Gründer.
Familie Kraut, die mit Elektrogeräten ("Bizerba") ein Vermögen von "nur" 450 Millionen scheffelte und damit am Ende der Reichstenliste zu finden ist, hat ihr Mitglied Nicole Hoffmeister-Kraut als Wirtschaftsministerin in die baden-württembergische Landesregierung geschickt. Diese direkte Wahrnehmung von "politischer Verantwortung" ist, im Gegensatz zu den USA, noch (?) ungewöhnlich für die Kaste der Allerreichsten.
"Als schnellster Weg, reich zu werden, gilt gemeinhin das Erben.", schreibt das Manager Magazin. Und bringt als Beispiel für "dumm gelaufen" die Erben von Heinz Hermann Thiele (Knorr Bremse), die bei seinem Tod ein Vermögen von 15 Mrd. Euro erbten; allerdings hatte er juristisch ungenügend vorgesorgt, sodass sie an den Freistaat Bayern (die Erbschaftssteuer ist eine Ländersteuer) 4 Mrd. Euro zahlen mussten. Mit 9 Mrd. Euro und Platz 23 geht es den beiden Töchtern aber wahrscheinlich doch recht gut.
Steuerpolitik im Interesse der SuperreichenSuperreiche und ihre Konzerne profitierten weltweit von Steuersenkungen und großzügigen Ausnahmeregelungen, während die Steuern für Milliarden von Menschen stiegen. In Deutschland spielen Lobbyverbände wie „Die Familienunternehmer e.V.“ und die „Stiftung Familienunternehmen und Politik“ bei der Durchsetzung einer solchen Steuerpolitik eine wesentliche Rolle. Das Ergebnis: Milliardärinnen und Multimillionärinnen zahlen vielerorts weniger Steuern auf ihr Einkommen als der Rest der Bevölkerung.
Gewinne für Superreiche durch steigende KonzernmachtWeitere Vorteile für Superreiche ergeben sich aus der zunehmenden Monopolisierung der Wirtschaft. Einzelne Branchen werden von immer weniger Unternehmen dominiert. Die 20 reichsten Menschen der Welt sind EigentümerInnen oder GroßaktionärInnen von Großkonzernen, von denen viele durch eine marktbeherrschende Stellung so mächtig wurden. Aus Oxfams Bericht zu sozialer Ungleichheit. Milliardärsmacht beschränken, Demokratie schützen.
Die Reichstenliste "bietet Nutzwert für Menschen, die sich professionell mit Hochvermögenden befassen.", schreibt die Redaktion. Aber auch für Menschen, die sich mit einem Gesellschaftssystem nicht abfinden wollen, in dem die Reichsten immer reicher und mächtiger werden, haben diese Sonderhefte mit ihren akribisch zusammengestellten Zahlen und Fakten großen Nutzwert für gewerkschaftliche und politische Arbeit.
„Vertrauenskrise“ des Kapitalismus in Deutschland – doch wem nützt es?
Der „Herbst der Reformen“ zeigt wenig Wirkungskraft: Die eingesteuerten politischen Maßnahmen der Deregulierung, steuerliche Entlastungen für Industrie-Konzerne sowie die Einsparungen für soziale Errungenschaften vermögen es nicht, das verloren gegangene Vertrauen deutscher Unternehmen in die Zukunft aufzuhalten.
Die vom Institut für Demoskopie Allensbach im Auftrag von FTI-Andersch durchgeführte Befragung von 169 Industrieunternehmen, Mitte Oktober 2025, liefert Erkenntnisse des verbreiteten Zukunfts-Pessimismus in Deutschlands zentralen Industrie-Branchen. Ein erheblicher Teil der Firmen (51 %) bezweifelt die eigene künftige Wettbewerbsfähigkeit und prognostiziert Stagnation oder Abschwung im Geschäftsverlauf der nächsten zwölf Monate. Besonders betroffen geben sich die Auto-Zulieferer: 60 Prozent von ihnen sehen keine Chancen mehr, eine Geschäftstätigkeit im boomenden Automarkt China aufzunehmen, und über die Hälfte der Maschinenbauer befürchtet, die derzeit in Teilbereichen noch angenommene Technologieführerschaft bald an internationale Wettbewerber zu verlieren. Unternehmen energieintensiver Sektoren, etwa aus Chemie und Stahl, geben zu 94 Prozent an, eine Verlagerung ihrer Produktionsanlagen ins Ausland ernsthaft in Erwägung zu ziehen.
Globale Unsicherheiten, wirtschafts- und geopolitische Krisen sowie Störungen in den Lieferketten verstärken die Herausforderungen aus Sicht der Betriebe. 83 % der Studien-Teilnehmer berichten von einer deutlich erschwerten Planbarkeit, infolgedessen 63 % ihre Investitionen verschieben.
Die jüngsten Reformmaßnahmen der Bundesregierung werden von den Unternehmen bislang wenig als Erfolgstreiber empfunden und das Zutrauen in eine starke Reform-Politik bleibt aus. (1) Laut der Studie beurteilen 83 Prozent der Unternehmen die Planung der Geschäftsentwicklung der kommenden Monate inzwischen als sehr schwierig und demzufolge verschiebt jeder zweite der Befragten (63 Prozent) anstehende Investitionen.
Der gewählte Studientitel „Deutsche Unternehmen verlieren ihr Vertrauen an die Zukunft“ offenbart anscheinend eine massive „Vertrauenskrise“ im deutschen Industriesektor und führt zu der Annahme, dass die Industriebranche nicht mehr auf die Wirtschaftskraft eines exportlastigen, aber innovations-retardierenden Volkswirtschaft vertraut und den Versprechen der politischen Entscheidungsträger immer weniger Glauben schenkt. Gemeint sind hier die großmannsüchtigen Ankündigungen der aktuellen CDU/CSU/SPD-Regierung, dass im Sinne deutscher konkurrenzfähiger Wirtschaftspolitik jetzt alles besser und der Abstiegssog bald „reformerisch“ gestoppt werde. (2); (3)
Nach Auffassung der mit der Befragung beauftragten Beratungs-Firma FTI-Andersch zeigt die Studie, dass viele Unternehmen selbst zu verantwortende strukturelle Probleme in ihren Geschäftsmodellen hätten und Deutschland nicht nur aufgrund schlechter externer Rahmenbedingungen im internationalen Wettbewerb zurückgefallen sei.
Neben den Beispielen Maschinenbau und Chemie-u. Stahl-Industrie führt die Studie aus, dass es 8 von 10 Firmen der Autozuliefer-Branche nicht gelungen sei, an dem mächtig wachsenden Elektro-Automobilmarkt China teilzuhaben und den Rückgang der Belieferung deutscher Automobilunternehmen dadurch mindestens zu kompensieren.
Einen Ausweg sehen 79 Prozent der Auto-Zulieferer durch die Ausweitung ihrer Tätigkeit in anderen Branchen wie etwa der Energiebranche, der Medizintechnik, der Luftfahrt oder der Bahntechnik und vor allem durch die Ausweitung und Teilhabe an dem in Deutschland sich aufblähenden Rüstungsbereich. Die Aussichten auf eine Teilhabe an den schuldenfinanzierten Rüstungs-Milliarden drängt die Auto- und Zulieferbranche zur Geschäftserweiterung. Eine solche Teilhabe am Bau von Panzern und Drohnen wäre für die Zulieferbranche und Auto-Konzerne eine profitable Erweiterung ihres angestammten Geschäftsfeldes ziviler Fahrzeug-Produktion. (4)
Während führende Wirtschaftsinstitute noch argumentieren, die Rückgänge bei Auftragseingängen, Absatz, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit seien normale zyklische Schwankungen, erkennen inzwischen selbst Vertreter dieser Schulen, dass es sich um strukturelle Krisenerscheinungen handelt. Diese lassen sich nicht mehr durch kurzfristige Reformprogramme, Zugeständnisse an die privatwirtschaftlichen Unternehmen sowie Ausgaben-Kürzungen sozialer Leistungen in das „Lot“ der kapitalistischen Wirtschaftslogik zurückführen, sondern erfordere einen grundlegenden wirtschaftspolitischen und gesellschaftlichen Umbau. (5)
Es handelt sich also um strukturell geprägte Widersprüche, die sich aus den sich verschlechternden Verwertungsbedingungen der spätkapitalistischen Produktionsweise ergeben. So räumt auch die Bundesbank ein, dass die deutsche Wirtschaft in einer längeren Phase verhaltener Wachstumsperspektiven, erforderlicher struktureller Anpassungen und sozialen Verwerfungen stehe. Derartige makrowirtschaftliche Prognosen der Bundesbank, des ifo-Instituts und des Instituts der deutschen Wirtschaft führen aus, dass die Ursachen weit über zyklische Abschwächungen hinausreichen und auf eine mehrdimensionale Strukturkrise hindeuten. Sie legen den Schluss nahe, dass die deutsche Wirtschaft vor einem Übergang zu einem postindustriellen, durch Wohlstandsverluste und Fragmentierung geprägten Entwicklungszyklus stehe. (6) Die Analysen räumen ein, dass ein tiefgreifender Wandel der gesellschaftlichen Reproduktionsbedingungen anstehe, der auf die strukturellen Widersprüche innerhalb der spätkapitalistischen Produktionsweise verweist.
Diese Widersprüche entspringen aus gesellschaftskritischer Sicht aber nicht einzelnen Fehlentwicklungen oder kurzfristigen Marktstörungen, sondern sind den sich verschlechternden Verwertungsbedingungen des Kapitals selbst zuzuschreiben.
Schwindendes Vertrauen der Unternehmen – in was?So betrachtet ist die Aussage der zuvor zitierten Allensbach-/FTI-Studie, dass deutsche Unternehmen eine Phase großen Vertrauensverlusts in ihr eigenes kapitalistische Wirtschaften „durchmachen“, eher als moralischer oder psychologischer Zustandsbericht zu bewerten, der die ideologische Struktur des bürgerlichen Bewusstseins widerspiegelt.
Die eigentliche Grundlage der wirtschaftlichen Stagnation eines Produktionsprozesses wird demgegenüber in der Studie nur als Randnotiz erwähnt, bei dem die Organisation, Steuerung und Zielsetzung der Produktion primär auf die Erzielung von Profit ausgerichtet ist und die wirtschaftliche Verwertbarkeit und maximale Kapitalrendite als Wirtschaftsziel bestimmt.
Besonders für Deutschland ist es in der jetzigen Wirtschaftssituation zutreffend, dass die über Jahre auf Waren-Export basierende Profit-logik zunehmend an ihre inneren und äußeren Grenzen stößt: Globale Märkte sind weitgehend erschlossen, natürliche Ressourcen übernutzt und technologische Rationalisierung führt zu einer Entwertung menschlicher Arbeit in einem Ausmaß, das den Übergang zu neuen Zyklen der Kapitalakkumulation erschwert. Immer größere Mengen an Kapital finden keine hinreichend profitable Anlagemöglichkeit in der Produktion realer Güter, so dass spekulative, renditeträchtige Finanzmärkte die reale Wertschöpfung ersetzen.
Hinzu kommt eine wachsende Diskrepanz zwischen Produktionsvermögen und gesellschaftlichem Bedarf. Während technische Produktivität und globale Lieferketten ein potenziertes materielles Produktionsniveau ermöglichen, bleiben weite Teile der Bevölkerung von dieser Produktivität ausgeschlossen und sie werden von allgemeinen Wohlstandsgewinnen ausgeschlossen. Eine staatliche Nachfragestimulierung durch eine an der Mehrheit ausgerichteten Wirtschaftspolitik würde in erster Linie der Masse der privaten Haushalte als die wichtigsten Nachfrager zugutekommen. (7)
Der Wohlstand für die Bevölkerung stagniertNachdem dies aber weitestgehend ausbleibt, entstehen neue Formen sozialer Prekarität, verschärfte Konkurrenz und Abbau von Arbeitsplätzen sowie eine Übernutzung von natürlichen Ressourcen. (8) Und das BIP, das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf als wichtiger Wohlstandsindikator, stagniert insbesondere in Deutschland. Diese Stagnation bedeutet nicht nur ausbleibendes Wirtschaftswachstum, sondern auch stagnierende Realeinkommen für große Teile der Bevölkerung. Ein kontinuierlicher Anstieg des BIP pro Kopf, der früher Wohlstandsversprechen erfüllte, verweist heute signifikant auf die erreichten Grenzen des wachstumsorientierten Modells.
Im folgenden Schaubild zeigt sich die Wohlstandentwicklung für Deutschland im internationalen Vergleich in den vergangenen 10 Jahren.
Die Ursachen liegen wie oben angeschnitten in der Überakkumulation von Kapital, sinkenden Profitraten und der Verlagerung von Wertschöpfung in spekulative Bereiche, d. h. in Aktivitäten, die nicht unmittelbar zur Produktion von realen Gütern oder Dienstleistungen beitragen, sondern primär auf Finanzgewinne durch Spekulation abzielen (Han del mit Aktien, Anleihen etc. ausgerichtet sind. Der technologische Fortschritt führt gleichzeitig zu Rationalisierung und Arbeitsplatzabbau, ohne dass neue, gleichwertige Beschäftigungsmöglichkeiten entstehen. Der materielle Wohlstand der Lohnbeschäftigten stagniert. Der "Wohlstand" konzentriert sich zunehmend bei Kapitaleigentümern, während die Mehrheit der Bevölkerung von den Produktivitätszuwächsen abgekoppelt wird. Die BIP-Stagnation signalisiert somit eine systemische Krise des Kapitalismus.
Die vorherrschende Unternehmer-Mentalität in DeutschlandDie durch die Allensbach-Studie ermittelte „Vertrauenskrise“ ist dieser Argumentation folgend also nicht in „Mentalitätsproblemen“ der Unternehmer zu suchen, sondern in der inneren Widersprüchlichkeit der kapitalistischen Produktionsweise. Die Denkweise der Unternehmer ist kein persönlicher Charakterzug, sondern spiegelt ein Bewusstsein wider, das aus den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen der Produktion hervorgeht. Sie entsteht nicht im Einzelnen, sondern in jener Ordnung, die Gewinnstreben zur obersten Maxime macht.
Mit anderen Worten: Wenn Unternehmer über schrumpfende Profite und schlechte Verwertungsbedingungen jammern, so wie die Studie es zum Ausdruck bringt, ist dies weniger als ein psychologisches Versagen zu verstehen, sondern vielmehr als eine durch Fakten belegbare Reaktion auf abnehmende Gewinnmöglichkeiten. Das „Jammern“ über schrumpfende Profite spiegelt eher die reale ökonomische Situation wider als eine anfällige psychologische Haltung der Unternehmer.
Es ist die langfristige Tendenz im kapitalistischen Wirtschaftssystem, bei der die Profitrate, also das Verhältnis von Profit zum eingesetzten Kapital, trotz technischem Fortschritt und Produktivitätssteigerungen langfristig abnimmt.
Sollte sich der tendenzielle Fall der Profitrate nicht aufhalten lassen, würde er zu einer unüberwindbaren Grenze der kapitalistischen Akkumulation werden und könnte die Überlebensfähigkeit des Kapitalismus als Wirtschafts- und Gesellschaftssystem gefährden. (Karl Marx); (9)
Und so erklären sich generell die Handlungsoptionen kapitalistischer Unternehmen, Profit-Einschränkungen nach Möglichkeit durch Kosten-Einsparungen, technologische Rationalisierung, Produktionsoptimierungen und Verlagerungen zu kompensieren, was die Zahl der Beschäftigten reduziert und zugleich die gesamtgesellschaftliche Nachfrage senkt. (10)
Der daraus resultierende Nachfragemangel wird in der bürgerlichen Ökonomie als „Konsumzurückhaltung“ gedeutet, während er in Wahrheit Ausdruck der krisenhaften Dynamik der Überproduktion ist. Die strukturelle Perspektivlosigkeit bleibt bei fortgesetztem Personalabbau dabei ungelöst bestehen. Eine wahrhaft echte Perspektive wäre durch den Fokus auf die Aufhebung der Ausbeutung und der Schaffung gesellschaftlicher Produktionsverhältnisse zu sehen, statt auf individuelles Konsumverhalten. (11)
Die politische Rhetorik der aktuellen Bundesregierung verstärkt die „Vertrauenskrise“Die angekündigte Reformoffensive im Herbst durch die Bundesregierung zielt darauf ab, staatliche Aufgaben zurück in private Hände zu überführen und die Arbeitsmärkte zu deregulieren. Diese Maßnahmen werden politisch begleitet mit der Aufforderung an Gewerkschaften und Interessensvertreter der Arbeiterschaft, bei Lohnverhandlungen, Forderungen nach Weihnachtsgeld sich zurückzuhalten, um zum Erhalt von Arbeitsplätzen beizutragen. Gleichzeitig wächst auch der Druck auf die Vertretungen der Beschäftigten, insbesondere der Gewerkschaften, welche sich im Rahmen einer vermeintlichen Tarifpartnerschaft und einem gesellschaftlichen Konsens darauf konzentrieren sollen, die Profitabilität zu gewährleisten, anstatt die gesellschaftliche Reproduktion sicherzustellen.
Die derzeitige Regierungskoalition aus CDU/CSU und SPD übernimmt dabei die Rolle des „ideellen Gesamtkapitalisten“, der die langfristigen Bedingungen für die Kapitalverwertung schafft und absichert. Aber das scheint bei den Unternehmern und Kapital-Verwaltern nicht anzukommen und den Erwartungen nicht zu entsprechen. So betrachtet wird die beschriebene „Vertrauenskrise“ zur ideologischen Frage der fortschreitenden Verwertungsprobleme innerhalb der Kapitalfraktion des in der Studie berücksichtigten Industrie-Sektors.
Festzuhalten bleibt, dass die hier behandelte „Vertrauenskrise“ als eine Erscheinungsform bürgerlicher Ideologie eingeordnet werden kann. Eine Vertrauenskrise ist in der kapitalistischen Vergesellschaftung keine Störung sozialen Zusammenhalts, sondern Ausdruck ihrer strukturellen Widersprüche. Vertrauen wurzelt in einer kapitalistischen Gesellschaft nicht im direkten persönlichen Kontakt, in gemeinsamer Erfahrung oder gegenseitiger Verlässlichkeit, wie es in gemeinschaftlichen Strukturen der Fall wäre. Stattdessen entsteht es durch abstrakte, unpersönliche Mechanismen, über den Markt, über das Geld und über das Eigentum. Menschen vertrauen nicht direkt einander, sondern den Institutionen und Mechanismen des Kapitalismus, die ihre gesellschaftlichen Beziehungen durch Konkurrenz und Profitstreben vermitteln.
Wenn diese Vermittlungen – etwa in Finanz- oder Produktionskrisen – brüchig werden, erscheint der Verlust von Vertrauen als moralisches oder psychologisches Problem, als Versagen einzelner Akteure, Institutionen oder als Brüche im Glauben an den Markt, aber nicht als Folge des kapitalistischen Gesellschaftssystems. Und dadurch überdeckt die Rede von der Vertrauenskrise die eigentliche Ursache: die Instabilität kapitalistischer Vergesellschaftung selbst.
Die Untersuchungsergebnisse der Allensbach-Studie Unternehmer verweisen u. a. auf massiv geplante Produktionsverlagerungen der deutschen Industrie-Unternehmen. Es geht den Unternehmen offensichtlich darum, gezielt Standorte mit günstigeren Steuergesetzen und weniger bürokratischen Hürden im Ausland zu nutzen. Erwartet werden niedrige Körperschaftssteuersätze, Steuervergünstigungen für Investitionen sowie flexible Arbeitsgesetze, um eine merkliche Erhöhung des Nettoprofits realisieren zu können. In der Folge belegen die befragten Unternehmen ihr offen vorgetragenes Interesse am Sozialabbau und an Steuerentlastungen. Die Unternehmerklasse übt (auch) dadurch politischen Druck aus, damit der Standort Deutschland vor allem für sie wettbewerbsfähig bleibt. Die aktuelle Bundesregierung kommt diesen Forderungen mit steuerpolitischen Reformen entgegen, beispielsweise durch Senkung der Körperschaftssteuer und Entlastung bei Stromkosten. Doch für viele Unternehmen erfolgt dies offenbar zu langsam oder ist von ihrer Wirksamkeit für sie zu wenig.
Die Lohnabhängigen in Deutschland tragen die negativen Folgen dieser sich abzeichnenden Strukturverlagerungen; Arbeitsplatzverlust, Lohndruck und die Gefahr von Sozialabbau sind direkte Ergebnisse geplanter und sich vollziehender Auslandsverlagerung der Produktion. Das Kapital nimmt dies in Kauf, da die Sicherung der Profitrate im globalen Maßstab Vorrang vor nationalen sozialen Interessen hat.
-----------------
Quellen:
(2) W. Sabautzki: Reine Klassenpolitik, in Marxistische Blätter,4/2025;
(8) Ulf Immelt: Transformation, Krise, Deindustrialisierung, in Marxistische Blätter, 4/25
(9) https://zeitschrift-luxemburg.de/artikel/der-tendenzielle-fall-der-profitrate/
(11) H. Zdebel: Klassenkampf statt Konsumkritik, in: nd Journalismus von links, 2017
Kriegstreiber John Bolton Angeklagt
In diesem Video, das exklusiv auf Deutsch auf unserem Kanal veröffentlicht wurde, kommentiert der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Journalist Glenn Greenwald die Anklage gegen den ehemaligen US-Sicherheitsberater John Bolton wegen des Missbrauchs von Verschlusssachen. Er untersucht die Details des Falls und die breiteren Reaktionen der Medien und der Politik darauf. Dieses Video wurde von System […]
Der Beitrag Kriegstreiber John Bolton Angeklagt erschien zuerst auf acTVism.